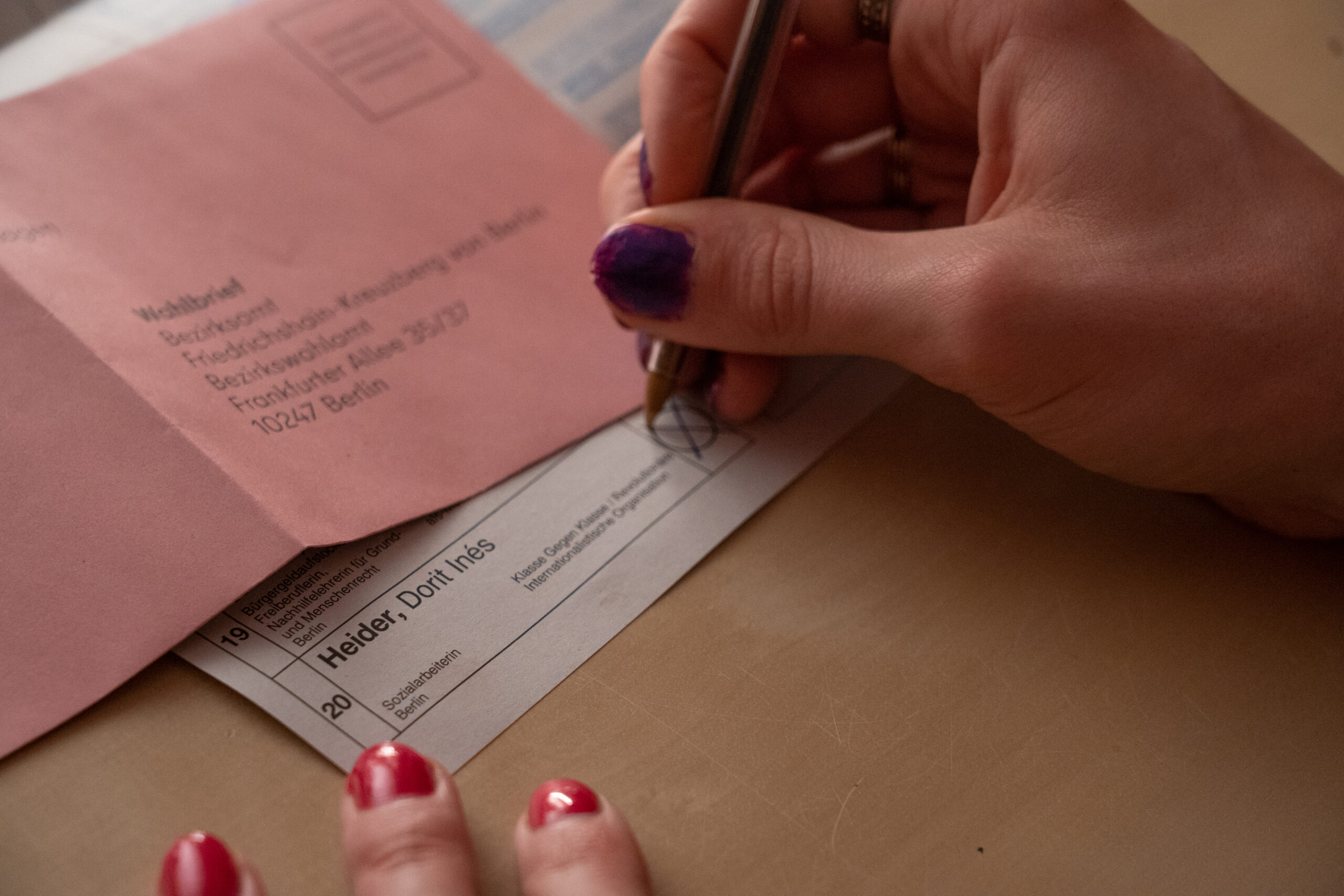Warum kam die Linkspartei in NRW nicht in den Landtag?

Auch eine Woche nach den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen geht unter Linkspartei-Mitgliedern auch mit Blick auf die Bundestagswahl die Frage um: Warum hat es trotz einem guten Wahlkampf nicht für den Einzug in den Landtag gereicht? Eine Erklärung legt die tiefen Probleme der reformistischen Partei offen.
Als „bitterer Erfolg“ wurde das Wahlergebnis der Linkspartei bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, der „kleinen Bundestagswahl“, von Seiten der Parteispitze bezeichnet. Mit einem kämpferischen Wahlkampf konnte die Linkspartei viele ihrer verlorenen Wähler*innen zurückgewinnen. Am Ende fehlten weniger als 9.000 Stimmen, die den Einzug in den Landtag verhinderten.
Tatsächlich ist es so: Mit rund 415.000 Stimmen kommt die Linkspartei wieder an ihr starkes Ergebnis von 2010 ran, in dessen Folge sie in den Landtag einzog und eine rot-grüne Minderheitsregierung unterstützte. Zwei Jahre später verlor sie die Hälfte ihrer Stimmen und kam nur auf rund 200.000. Diese Verluste konnten wieder wettgemacht werden.
Die undemokratische Fünf-Prozent-Hürde hat in diesem Fall ihren eigentlichen Zweck gut erfüllt: die Präsenz linker und proletarischer Parteien in den Parlamenten einschränken. Neben den allgemeinen Schwierigkeiten, die besonders kleinere Organisationen beim Wahlkampf haben, die sich hauptsächlich aus Lohnabhängigen zusammensetzen, dient die Fünf-Prozent-Hürde als letzter Riegel, um die demokratische Vertretung dieser Gruppen zu verhindern. Und auch wenn die Linkspartei diesmal ein Opfer dieser Hürde wurde, führt sie keinen aktiven Kampf gegen diese – oder andere – Einschränkungen der demokratischen Rechte und Freiheiten.
Gute Ausgangslage für ein linkes Programm
Trotzdem müssen die tieferliegenden Gründe für dieses Abschneiden gefunden werden. Schließlich schien die Ausgangslage wie für die Linkspartei geschaffen: Zwar konnten die rechten Parteien besonders zum wichtigen Thema „Innere Sicherheit“ punkten, das in NRW eine besondere Bedeutung hatte. Doch der Wahlkampf war zum großen Teil von der Enttäuschung über die Bildungs- und Sozialpolitik von SPD und Grüne und den maroden Zustand in den Schulen geprägt. Noch vor der inneren Sicherheit (15 Prozent, infratest dimap) gehörten zu den zwei wahlbestimmenden Themen die Situation an den Schulen (29 Prozent) und die internationale unsichere Lage (22 Prozent). Wäre es nicht ein leichtes gewesen, in das Parlament einzuziehen mit einem klaren Programm, das den Ausbau der öffentlichen Bildung auf Kosten der Reichen und eine klare Absage an Bundeswehreinsätze und Waffenexporte aufstellt?
Tatsächlich konnte die Linkspartei mit einem kämpferischen Wahlkampf und fortschrittlichen Forderungen viele neue Stimmen bekommen und alte zurückgewinnen. Besonders in Städten, in denen die Linkspartei verankert ist, und dort, wo ein aktiver Wahlkampf geführt wurde, konnten überdurchschnittlich gute Ergebnisse erzielt werden. Auch das Programm ist im Vergleich zu anderen Landesverbänden „linker“. So forderte die Linkspartei zum Beispiel eine Arbeitszeitverkürzung bei Lohnausgleich, fahrscheinlosen ÖPNV, garantierte kostenlose Kita-Plätze und den Ausbau des öffentlichen Wohnungsbaus.
Sicherlich wünschen sich viele Arbeiter*innen und Jugendlichen, dass solche Forderungen erfüllt werden würden. Doch gleichzeitig haben die Spitzenkandidat*innen die Möglichkeit einer Koalition mit SPD und Grünen – also den gleichen Parteien, die für das Elend verantwortlich waren – betont. Wieso sollte denn ein*e enttäuschte*r Ex-SPD-Wähler*in die Linkspartei wählen, nur um dadurch Hannelore Kraft zu einer weiteren Amtszeit zu verhelfen?
Keine glaubhafte Alternative durch Regierungskurs
Interessant ist in diesem Kontext auch die Tatsache, dass die Linkspartei unter zwei für sie wichtigen Gruppen schlecht abschnitt: den Arbeiter*innen (auch wenn unter dieser Kategorie durch Umfrageinstitute nur die Industriearbeiter*innen einbegriffen sind) und den ehemaligen Nichtwähler*innen. Bei den Arbeiter*innen liegt sie selbst hinter der AfD und der FDP und sie konnte am wenigsten von der gestiegenen Wahlbeteiligung profitieren. Das drückt aus, dass die Betonung auf eine mögliche Regierungsbeteiligung auf die besonders unterdrückten und marginalisierten Schichten keinen guten Eindruck machte. Im Gegenteil erschienen die Forderungen in diesem Licht weniger glaubwürdig.
Zudem kann jeder Mensch sehen, welche Auswirkungen eine linke Regierungsbeteiligung in Landesregierungen wie Thüringen, Brandenburg oder Berlin hat: gar keine. In all diesen Ländern finden weiter Zwangsräumungen statt, wird abgeschoben und mit der Schuldenbremse Kürzungen im Haushalt begründet. Keine Landesregierung mit linker Beteiligung konnte bis auf minimale Zugeständnisse substantielle Veränderungen für die Arbeiter*innen und Jugendlichen erzielen. Im Gegenteil kommt es zu Situationen, in denen Parteimitglieder der Linken gegen die Politik ihrer eigenen „Minister*innengenoss*innen“ auf die Straße gehen – eine glaubhafte Wahlalternative sieht anders aus!
Sozialchauvinistin Wagenknecht
Ein weiterer Grund für das Abschneiden lag in der Parteispitze. Sahra Wagenknecht ist nicht nur die Spitzenkandidatin der Linkspartei für NRW bei der Bundestagswahl, sondern hat auch – genauso wie alle anderen Parteichefs von Angela Merkel bis Martin Schulz – aktiven Wahlkampf betrieben. Als bekannte Figur der Partei steht sie für viele Menschen sinnbildlich für die Partei und ihre Worte zählen deshalb mehr als Tausend Flyer.
Gerade Wagenknecht hat sich jedoch seit Ausbruch der Migrationskrise dadurch ausgezeichnet, soziale Verbesserungen für Einheimische gegen soziale und demokratische Rechte von Geflüchteten und Migrant*innen auszuspielen. Mit Sätzen zum „Gastrecht“ und vielen anderen Aussagen hat sie rassistische Ressentiments geschürt und ist bei der AfD auf Stimmenfang gegangen. Das verstärkte den Eindruck gerade unter linken und antirassistischen Aktivist*innen, dass die Linkspartei nicht konsequent gegen Abschiebungen und die Asylgesetzverschärfungen kämpft, sondern lieber mit sozialchauvinistischen Parolen auf Stimmenfang geht. Was soll man schon von einer offiziell antirassistischen Partei halten, die eine Hetzerin zur Spitzenkandidatin macht? Und dazu in den Ländern, wo sie regiert, abschiebt?
Auch wurde das Thema Antirassismus im Wahlkampf nicht zentral behandelt, obwohl es ein wichtiger Grund vieler Wähler*innen war, das Kreuz bei der Linkspartei zu machen. Was die Partei links verlor, verlor sie jedoch auch rechts: Denn die einzige Partei, an die Die Linke Stimmen verlor, war die AfD. Wie im Leben ziehen in der Politik Wähler*innen meist das Original der schlechten Kopie vor.
Es lässt sich festhalten, dass es gute Ergebnis da gab, wo die Linkspartei eine aktive Basis hatte. Und diese Basis besteht oftmals aus Aktivist*innen mit revolutionär sozialistischem Selbstverständnis. Sie machen einen tollen Wahlkampf – aber für Regierungssozialist*innen und Minister*innen auf Abruf. Und dadurch ist der ganze radikale Wahlkampf unglaubwürdig.
Rechter Flügel der Partei zieht die falschen Schlussfolgerungen
Innerhalb der Partei wird jetzt besonders der rechte Flügel als Schlussfolgerung den „zu radikalen“ Wahlkampf angreifen und für ein noch stärkeres Werben um die SPD und das Aufgeben der letzten Haltelinien eintreten. Doch anstatt einen innerparteilichen Kampf gegen die Bartsch, Kipping und Co. zu führen, um im September für sie Wahlkampf zu machen, schlagen wir diesen Genoss*innen vor, eine eigene, sozialistische Partei aufzubauen, die unabhängig vom Staat ist, gegen den Reformismus von SPD, Gewerkschaftsbürokratie und Linkspartei kämpft und für ein Programm der Arbeiter*innen, Frauen und Jugendlichen eintritt, das die Kapitalist*innen für die Kosten ihrer Krise zur Kasse bittet.
Eine solche Partei würde ein Programm aufstellen, das dringende Forderungen wie das Ende sachgrundloser Befristung, Leiharbeit und Hartz IV, die Erhöhung des Mindestlohns, die Arbeitszeitverkürzung durch Aufteilung der Arbeit auf alle verfügbaren Arbeiter*innen bei vollem Lohnausgleich beinhaltet. Doch diese Forderungen würden auch mit antirassistischen und antisexistischen Forderungen verbunden werden und der über die bürgerliche Gesellschaft hinausreichende Perspektive der Verstaatlichung der Großbetriebe unter Arbeiter*innenkontrolle und einer revolutionären Arbeiter*innenregierung aufstellen. Ein solches Programm könnte natürlich nur mit dem Kampf und der Mobilisierung der Arbeiter*innen und Jugendlichen geschehen und nicht in Verhandlungen mit dem „linken“ Flügel des BRD-Regimes. Dafür ist die Selbstorganisierung der Ausgebeuteten und Unterdrückten und besonders auch der Kampf gegen die sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaftsführungen nötig.
Eine solche Organisation würde zwar kurzfristig auch nicht von unten an der Fünf-Prozent-Hürde kratzen, böte jedoch einen Anziehungspol für die revolutionäre Linke, die fortgeschrittensten Jugendlichen und kämpferische Arbeiter*innen. Das hätte eine viel größere Bedeutung für den Klassenkampf, wie auch schon Rosa Luxemburg vor 99 Jahren feststellte:
Sozialismus heißt nicht, sich in ein Parlament zusammensetzen und Gesetze beschließen, Sozialismus bedeutet für uns Niederwerfung der herrschenden Klassen mit der ganzen Brutalität, die das Proletariat in seinem Kampfe zu entwickeln vermag.