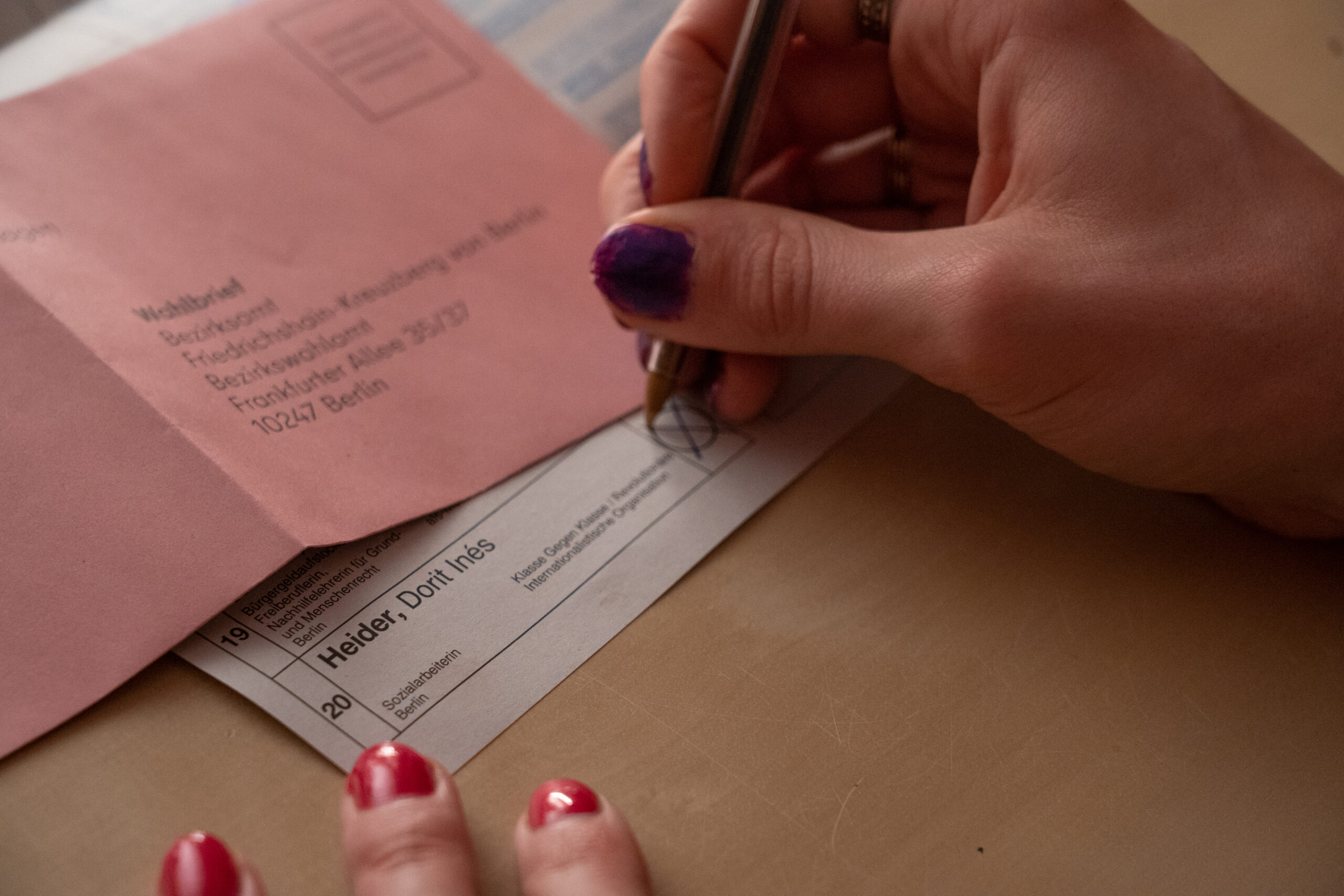Mit #Occupy ins Neuland?

// Bilanz und Perspektiven der Occupy-Bewegung in Deutschland und weltweit //
Der Arabische Frühling läutete Anfang 2011 ein Jahr der weltweiten Proteste ein. Er führte nicht nur zu den heftigsten politischen Umwälzungen, die Nordafrika seit Jahrzehnten erlebt hat (und deren Ende noch nicht abzusehen ist), sondern prägte auch die nachfolgenden Massenmobilisierungen in anderen Teilen der Welt: Tausende Menschen im Spanischen Staat besetzten ab Mai öffentliche Plätze wie die Puerta del Sol oder den Plaça Catalunya, die nicht zufällig in „Tahrir“ umgetauft wurden. Auch in den USA war es durch die Auswirkungen der Krise 2007/2008, die Millionen Menschen ihrer Häuser und ihrer Jobs beraubt hat, nur eine Frage der Zeit, bis sich Protest formieren würde. Am 17. September war es dann soweit: Zum ersten Mal fand in New York eine Demonstration unter dem Slogan „Occupy Wall Street“ statt. Auch wenn es in den vergangenen Jahren in den USA hin und wieder Proteste gegen die „Rettungspakete“ für Banken oder größere Mobilisierungen wie gegen die Einschränkung der gewerkschaftlichen Rechte in Wisconsin gab, so sollte OWS noch wesentlich weitere Kreise ziehen.
An der ersten Demonstration nahmen etwa 1.000 Menschen teil. Wenige Wochen später marschierten bereits 15.000 durch New York, während auch in anderen Städten Occupy-Demonstrationen stattfanden. Es mobilisierten sich vor allem Jugendliche, Studierende und AkademikerInnen, aber auch Arbeitslose und GeringverdienerInnen, ebenso wie Selbständige und andere Angehörige einer Mittelschicht, die sich von der Krise bedroht fühlt. Damit ist Occupy eine ihrem Wesen nach kleinbürgerliche Protestbewegung, die aber aufgrund ihrer progressiven Ausgangsidee und ihrer grundsätzlichen Offenheit und Aufgeschlossenheit zumindest das Potential hat, sich zu radikalisieren.
Die Forderungen
Die schnell populär gewordene Losung „We are the 99%“ macht auf einen fundamentalen Gegensatz zwischen einer kleinen, reichen und profitierenden Minderheit und einer unterdrückten und ausgebeuteten Mehrheit aufmerksam. Natürlich folgt daraus nicht automatisch die Erkenntnis, dass unsere Gesellschaft durch den Klassengegensatz von Kapital und Arbeit bestimmt ist, aber sie ist deutlich fortschrittlicher als das Motto „Echte Demokratie jetzt!“ der spanischen 15M-Bewegung.
Die Offenheit der Forderungen ist zugleich Stärke und Schwäche der Bewegung. Sie ermöglicht zum einen, dass hier Menschen mit sehr unterschiedlichen Positionen ihren Platz finden können. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Menschen dabei sind, aber auch die Gefahr, dass VerschwörungstheoretikerInnen ihre Gedanken verbreiten – aber vor allem wird das Finden einer kohärenten strategischen Ausrichtung dadurch nur schwieriger.
Auch wenn es keinen festen Katalog gab, waren bestimmte Forderungen und Slogans häufiger und deutlicher zu vernehmen als andere: Beschränkung der Macht der Banken und ihrer Lobby auf die Politik, ein Stopp der Rettungspakete für „bedürftige“ Banken und die Einführung einer Finanztransaktionssteuer sind einige davon. Gemeinsam haben diese Forderungen, dass sie sich allesamt wie eine Bitte an die Regierung richten und allein schon in dieser Hinsicht reformistisch sind. Statt der stärkeren Kontrolle von Unternehmen und Banken, müsste aber deren Enteignung und deren Verwaltung durch die ArbeiterInnen auf der Tagesordnung stehen, wenn das System geändert werden soll.
Mit dem Eintreffen der Occupy-Bewegung in Europa am 15. Oktober fand eine starke Vermischung (wenn auch nicht komplette Verschmelzung) mit der 15M-Bewegung statt. Hier konnte in einigen Ländern zu Massendemonstrationen mit mehreren hunderttausenden TeilnehmerInnen mobilisiert werden. In Deutschland waren die Demonstrationen gemessen am internationalen Maßstab klein, aber für die Verhältnisse in der BRD dennoch relativ groß.
Obwohl die nach der Demonstration am 15. Oktober vor dem Reichstag eingerichtete „Asamblea“ in Berlin am gleichen Tag geräumt wurde, etablierte sich in den folgenden Tagen und Wochen eine regelmäßige Occupy-Versammlung. Sie beschränkte sich jedoch auf höchstens 100 bis 200 TeilnehmerInnen und zeitweise sogar auf nur einige Dutzend Personen. Wer an dieser teilnahm, konnte aber auch schnell feststellen, dass sie sich oftmals mehr um sich selbst oder bestenfalls um allgemeine idealistische Selbstbestärkung drehte, als um politische Perspektiven oder konkrete Aktionen.
Aufgrund der konjunkturellen Lage in Deutschland waren es vor allem junge, idealistische Menschen, die selbst noch weniger direkt unter sozialen Einschnitten zu leiden haben, als ihre MitstreiterInnen in Griechenland, den USA oder andernorts, wo die Bewegung aufgrund der verschärften sozialen Lage eine deutlich größere Beteiligung hat.
Alles schonmal da gewesen?
Oftmals herrscht unter den „Empörten“, gerade unter den neu politisierten, der Eindruck vor, es handele sich um eine Bewegung, die in jeder Hinsicht Neuland betrete. Aber ganz im Gegenteil: Die Idee basisdemokratischer Versammlungen taucht nicht zum ersten Mal in der Geschichte gesellschaftlicher Kämpfe auf – nicht zuletzt in der russischen Revolution waren es die Sowjets die eine elementare Rolle in der Organisation der russischen ArbeiterInnenklasse und für deren Sieg spielten. Allerdings wurden in diesen Versammlungen Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip getroffen und Delegierte gewählt – beides Prinzipien, die in den Occupy-„Asambleas“ sehr umstritten sind. Vor allem aber handelte es sich bei den Sowjets um Versammlungen von arbeitenden Menschen an ihren Arbeitsplätzen, die dadurch die Möglichkeit hatten, großen wirtschaftlichen Druck auszuüben.
Die Ablehnung von Strukturen führt teilweise soweit, dass – aus einer verständlichen Abneigung gegenüber den etablierten Parteien – Organisationen im Allgemeinen nicht erwünscht sind. Anstatt zu unterscheiden, in wessen (Klassen-)Interesse eine Organisation oder Partei handelt, werden feste Strukturen aufgrund der ihnen angeblich innewohnenden Hierarchien rigoros abgelehnt. Dabei sind Hierarchien letztlich aufgrund der Arbeitsteilung in jeder größeren Organisation oder Bewegung notwendig. Wenn sie nicht formell festgelegt werden, dann bilden sich eben informelle Hierarchien heraus – wer hat am meisten Zeit, wer die besten Verbindungen, wer schreit am lautesten? Solche informellen Hierarchien sind der beste Weg zur Bürokratisierung und Entdemokratisierung einer Organisation, was ja eigentlich verhindert werden sollen. Erst bei einer formalen Bestimmung von Delegierten durch Wahlen kann eine Kontrolle der Delegierten durch die Basis stattfinden, wobei für uns als revolutionäre MarxistInnen Prinzipien wie die Rotation von Ämtern und die jederzeitige Abwählbarkeit von Delegierten grundlegend für basisdemokratische Prozesse sein sollen.
Um aber wirkliche Massenproteste konsequent und zielgerichtet führen zu können, ist eine gefestigte, gemeinsame Organisation notwendig – auch diese Lehre kann aus den Erfahrungen der historischen ArbeiterInnenbewegung gezogen werden. Anstatt vergangene Proteste zu ignorieren oder sie als „gestrig“ und unzeitgemäß anzusehen, sollte also versucht werden, von ihnen zu lernen.
Dazu sollten auch die Lehren zum Umgang mit der Polizei und der Gewaltfrage zählen. Die Occupy-Bewegung hat oft versucht, an die Polizei zu appellieren und sie als Teil der „99%“ zu sehen. Solange aber eine Staatsmacht existiert, die die vorhandenen Besitzverhältnisse zu verteidigen sucht, solange werden auch PolizistInnen in deren Dienst die Knüppel schwingen. Auch das hat die Geschichte mehr als einmal gezeigt. Daraus folgt wiederum, dass Gewaltverzicht niemals ein Dogma sein darf. Ab einem bestimmten Konfrontationslevel bedeutet absoluter Gewaltverzicht auch, sich nicht zu verteidigen und damit schwerste Verletzungen und Todesopfer in den eigenen Reihen hinzunehmen und langfristig den Kampf zu verlieren.
Berliner Besonderheiten
Die Berliner „Asambleas“ waren größtenteils stark auf sich selbst bezogen und konnten auch wegen ihrer kleinen TeilnehmerInnenzahlen kaum Außenwirkung erzielen. An der Freien Universität Berlin aber gab es seit dem Beginn des Wintersemesters statt eines Bildungsstreik-Komitees nun „Occupy FU“, welches ungewohnt großen Zulauf fand, auch von mehr unorganisierten InteressentInnen als üblich.
So war es möglich, den Arbeitskampf der CFM-Beschäftigten zum Thema zu machen und für gegenseitige Solidarität zu werben, was sowohl im Kontext der Occupy-Bewegung als auch des Bildungsstreiks der vergangenen Jahre eine sehr positive Entwicklung darstellt. Trotz der Teilnahme von CFM-Beschäftigten an der Bildungsstreik- und einigen Occupy-Demos gingen die gemeinsamen Aktionen jedoch nicht über eine leichte Annäherung hinaus. Die Berliner Asambleas vor dem Reichstag hatten für den Arbeitskampf kaum Verständnis. Aus ihren Reihen kam immer wieder Skepsis bis hin zu Anfeindungen gegenüber „den Systemgewerkschaften“ und der vermeintlichen „Durchsetzung von Partikularinteressen“ durch die Streikenden. In Frankfurt am Main kam es sogar dazu, dass ArbeiterInnen, die bei der IG Metall organisiert waren und entsprechende Fahnen dabei hatten, von den Occupy-AktivistInnen wieder nach Hause geschickt wurden. Nun halten wir eine scharfe Kritik an der Politik der Gewerkschaftsbürokratie für absolut notwendig – aber gleichzeitig bestehen wir auf einen gemeinsamen Kampf der ArbeiterInnen an der Basis mit gesellschaftlichen Bewegungen und auch im Inneren der Gewerkschaften gegen die eigene Bürokratie.
Einen Schritt weiter
Während in Deutschland noch der Nährboden für eine wirklich ernstzunehmende Bewegung fehlt, haben sich die Proteste im Ursprungsland von Occupy Schritt für Schritt weiterentwickelt. Nach einem harten Übergriff auf die Protestierenden in Oakland, Kalifornien, wurde für den 2. November zu einem Generalstreik in der Stadt aufgerufen, bei dem auch der Hafen lahmgelegt werden sollte. Damit wurde ein Schritt in Richtung der Zusammenarbeit mit der ArbeiterInnenklasse unternommen. Da sich die offizielle Gewerkschaftsbürokratie dem Aufruf nicht aktiv anschloss, gab es nur einen kleinen Teil der ArbeiterInnen, der wirklich in den Streik trat. Vor allem LehrerInnen und einige HafenarbeiterInnen unterstützten die Aktion. Diesen gelang es auch, den Hafen für mehrere Stunden stillzulegen.
Es kann nur von Vorteil sein, wenn sich der Aktionsfokus weg von eher symbolischen Besetzungen hin zur Besetzung und Blockade von Produktionsmitteln verschiebt. Es blieb auch nicht bei einer einmaligen Aktion: Am 12. Dezember wurden ähnliche Blockaden an mehreren US-Häfen durchgeführt. Und die Situation scheint sich weiter zu radikalisieren, wie die Ausschreitungen bei der letzten Occupy-Demo in Oakland Ende Januar zeigen. Insgesamt bieten sich gute Möglichkeiten für eine konsequentere Perspektive der Bewegung.
Denn auch wenn zahlreiche Occupy-Camps geräumt wurden und nur wenige die Wintermonate überdauern konnten: Die Bewegung ist damit wahrscheinlich noch nicht am Ende. Die soziale Situation in den USA und andernorts wird wohl kaum besser, sondern eher schlechter werden. Damit werden auch die Wut auf die ProfiteurInnen dieses Systems steigen und neue Impulse für eine Protestbewegung entstehen. Ob unter dem Label Occupy oder wieder unter einem anderen Namen – wichtig ist, dass sich der vorhandene Kern an AktivistInnen weiterentwickelt und dabei aus historischen Erfahrungen lernt. Für einen starken Protest braucht es ein Programm, welches die Verbindung mit der ArbeiterInnenklasse sucht, die Organisationsfeindlichkeit der Bewegung überwindet und für eine revolutionäre Perspektive einsteht. Dann könnte die Bewegung auch in der Lage sein, ernsthafte Antworten auf die bevorstehenden Angriffe in den imperialistischen Zentren zu geben.