Good for Something: Depressive Erfahrungen als politische Fragestellung
Zum Tod von Mark Fisher schreibt Gastautor David Doell über den Zusammenhang von Depression und Kapitalismus.
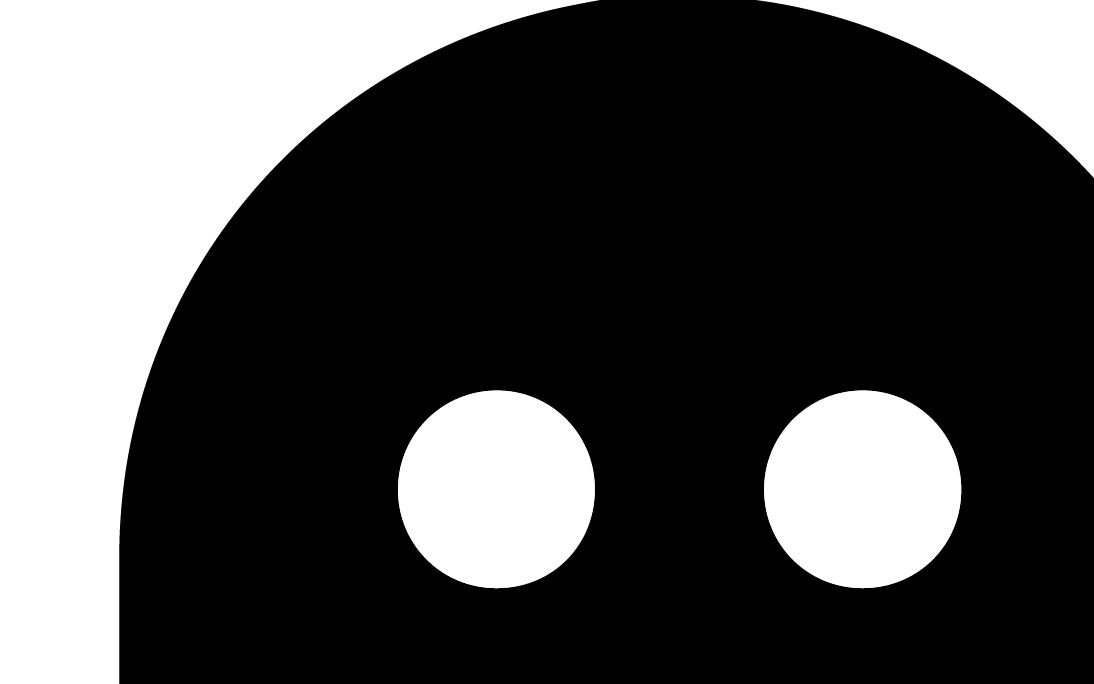
Vor drei Wochen hat sich der Autor, Kulturwissenschaftler und Hauntologe Mark Fisher das Leben genommen. Bekannt insbesondere durch das Konzept des „kapitalistischen Realismus“, der Theoretisierung der „Alternativlosigkeit“ in der neoliberalen Epoche des Kapitalismus, setzte sich Fisher auch mit dem Phänomen der Depression und dessen politischer Verfasstheit auseinander. In dem nach seinem Suizid vielfach geteilten Text „Good for Nothing“ [1] beschreibt er seine depressiven Phasen eindrücklich als zugleich individualisierte Leiderfahrungen und Ausdruck von sozialen Kräfteverhältnissen. Damit unternimmt Fisher einen performativen Akt, der in Klassenauseinandersetzungen interveniert, indem er anhand von eigenen Erfahrungen das (immer noch) tabuisierte Thema der Depression als politisches Kampffeld ausweist. Das Mutige seines Einsatzes liegt in der schonungslosen Aussprache über sich selbst, welche weder in Selbstmitleid umschlägt noch versucht Verantwortung wegzuschieben, wenn er die soziale Dimension seiner Erfahrungen erläutert. Im Folgenden möchte ich Mark Fishers Einsatz aufnehmen, in einem selbstreflexiven Dreischritt das Phänomen der Depression an eigenen Erfahrungen in den sozialpolitischen Kontext der Zeit einbetten und Perspektiven für die politische Praxis aufzeigen.
Das individuierte Phänomen
Depressionen werden teilweise von einer höhnischen „inneren“ Stimme erzeugt, die dich anklagt, zu nachgiebig gegen dich selbst zu sein – du bist nicht depressiv, du bemitleidest dich nur selbst, reiß dich zusammen – und diese Stimme ist anfällig, davon ausgelöst zu werden, dass du mit deiner Lage an die Öffentlichkeit gehst. Natürlich ist diese Stimme überhaupt keine „innere“ – es ist der internalisierte Ausdruck tatsächlicher sozialer Kräfte, von denen manche ein persönliches Interesse daran haben, jede Verbindung von Depression und Politik zu leugnen. Meine Depression war immer mit der Überzeugung verbunden, dass ich wortwörtlich zu gar nichts zu gebrauchen war. [2]
Es gibt vielfältige Ausprägungen von depressiven Erkrankungen, sowohl was die Dauer einer depressiven Episode als auch deren spezifische Ausprägungen und Intensitäten anbelangt. Die „Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN)“ gibt drei Hauptsymptome an: 1. Stimmungseinengung bis zu einem Gefühl der Gefühllosigkeit, 2. Interessenverlust und Freudlosigkeit und 3. Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit. Als Zusatzsymptome gelten: 1. verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, 2. vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, 3. Schuldgefühle und Gefühle von Minderwertigkeit, 4. negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, 5. Suizidgedanken oder -handlungen, 6. Schlafstörungen, 7. verminderter Appetit [3]. Werden drei der Hauptsymptome und fünf oder mehr der Zusatzsymptome festgestellt, wird von einer „schweren Depression“ gesprochen. Zusätzlich kann ein „somatisches Syndrom“ eintreten, was sich unter anderem in 1. Interessenverlust oder Verlust von Freude, 2. mangelnder Fähigkeit emotional zu reagieren, 3. frühmorgendlichem Erwachen, und 4. einem allgemeinen Morgentief äußern kann.
Mit dieser Liste erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit – vielfältige depressive Leiderfahrungen (die sich mit anderen Unterdrückungsverhältnissen überschneiden) werden darin wahrscheinlich nicht abgebildet –, sondern möchte viel eher einen Einblick in das teilweise undurchdringliche Labyrinth des depressiven Lebens geben. Sobald ich mich selbst in einer „schlechten Phase“ befinde, in der sich die depressive Erkrankung zuspitzt, bin ich in der Regel nicht in der Lage meine Leiderfahrungen in dieser Weise aufzuschlüsseln. Wenn ich Freund*innen schreibe, dass es mir „nicht so gut geht“, treffen in der Regel alle Haupt- und Zusatzsymptome zu, manchmal über mehrere Monate. Für mich ist eine depressive Episode dabei in jeden Fall auch immer mit somatischen Symptomen verbunden, und vielleicht sogar grundlegend (und zuerst) ein „Gefühl der Gefühllosigkeit“, eine Entfremdung von meinen körperlicher Wahrnehmungs- und Bewegungsmöglichkeiten. Es gibt während dieser langanhaltenden Phasen natürlich bessere und schlechtere Tage, Momente in denen ich Lesen oder Lachen kann, strukturell dominiert aber eine sich überlagernde Abfolge von Ermattungserscheinungen, Körperschmerzen und Versagensgefühlen, mit einem mal energetisch, mal hoffnungslos geführten Abwehrkampf.
Oftmals spitzen sich die Leiderfahrungen für mich in einer Weise zu, dass sie in einer allgemeinen Erstarrung und Handlungsunfähigkeit münden. An dieser Stelle bin ich oft tagelange nicht in der Lage etwas zu essen oder meine Wohnung zu verlassen. Ich habe das – teilweise auch somatische – Gefühl zu „sterben“, was sich – metaphorisch gesprochen – so anfühlt, als ob mein Körper keine Kraft mehr für grundlegende vitale Funktionen aufbringen kann, und sich eine unmittelbare und projektive Existenzangst einstellt. Spätestens an diesem Punkt werden exzessive Selbstmordphantasien zu einer tagträumerischen Alternativwelt, die das erlebe „Sterbensgefühl“ immerhin in der Hinsicht positiv übertreffen, als dass sie eine „Eigenaktivität“ simulieren (der Suizid ist eine Tat), und eine Aussicht auf ein Ende der unerträglich gewordenen Existenz bieten. Unerträglich scheint diese Existenz nicht nur als aktualer Schmerz, sondern auch als soziale Positionierung, nämlich als Scham vor dem eigenen Versagen.
In Zeiten in denen Scham als politisches Gefühl – insbesondere im Zuge der Eribon-Rezeption – (wieder) einen gesellschaftskritischen Gehalt zu bekommen scheint, möchte ich insbesondere auf diesen Aspekt eingehen, da er auch für die weitergehende Betrachtung der „Depression als sozialen Fragestellung“ wichtig sein wird. Scham scheint mir eine der zentralen Gefühlslagen zu sein, die mit der Freisetzung des „neuen Geist des Kapitalismus“ und der Verantwortlichmachung des Individuums und der hyperindividualisierten Leistungsgesellschaft einhergeht. Ich vermute, dass die oft beschworene Rede vom „abgehängten und prekarisierten Leben“ in der Figur der „depressiven Person“ einen Kulminationspunkt erreicht. Für nichts schäme ich mich mehr als dafür „depressiv“ zu sein, weder für meine Herkunft noch für meine Bildung, weder für meinen Mangel an ökonomischen noch an sozialem Kapital: Das Gefühl nichts zu können – nicht nur keine Produktionsmittel zu besitzen, sondern de facto (temporär) auch keine Arbeitskraft – ist das ultimative Schamerlebnis einer Epoche, die verspricht, dass jede*r zu allem in der Lage sei. Keine politische Arbeit machen zu können, nicht sprechen zu können (Angst davor haben angesprochen zu werden, Angst vor anderen Menschen zu haben), nicht studieren zu können, nicht (lohn)arbeiten zu können, keine Beziehung und keine Freundschaften führen zu können, nicht nach draußen gehen zu können (noch nicht einmal zum eigenen Therapeuten), nicht fragen zu können, ob meine Mitbewohner mir etwas zu essen kaufen können, keine E-Mails schreiben zu können, keinen positiven Gedanken finden zu können, nichts zu können – das ist die Wirkung einer depressiven Erkrankung.
Die Existenz in der Depression als zugespitztes Versagen(sgefühl) bedeutet die ewige Wiederkehr des Scheiterns an der Banalität des Alltäglichen. Die Existenz des*der Depressiven ist in diesem Stadium nicht mehr absurd, sondern vor allem versagend: Mein Leben kommt mir nicht sinnlos vor, sondern wie ein Tod, ein emotionales und soziales Sterben, das den physischen Tod in Schmerz und Selbsthass wahrscheinlich ungleich übertrifft. In dieser Verzweiflungslage und Erstarrung war für mich nichts hilfreicher als eine Reflexion über Depressionen, deren Ursachen und Wirkungen, zu lesen. Einmal weil es „den Feind“ benennt, aus der Sprachlosigkeit heraushilft und das Gefühl der Verlassenheit und Einsamkeit aufhebt. Und dann weil es als Analyse das Problem als gesellschaftliches fasst, und ein Distanzverhältnis zu dem eigenen Erleben ermöglicht.
Die gesellschaftliche Fragestellung
Im Folgenden sollen einige soziologische und sozial-philosophische Analyseschemata herausgearbeitet werden, um das Phänomen der Depression als Zeichen unserer Epoche und Stand der kapitalistischen Produktionsweise (in dessen Zentren) zu deuten. Die Fragestellung nach dem Zustandekommen von Depressionen, die sich auf einer individuellen wie auf einer kollektiven Ebene stellen lässt, soll deswegen insbesondere auch sozial-historisch behandelt werden.
Die Soziologie begründete sich als eigenständige Fachdisziplin im ausgehenden 19. Jahrhundert unter anderem mit Durkheims Forschungen zum Suizid und dessen sozialer Bedingtheit. Deswegen möchte ich zunächst kurz auf die Suizidrate in Deutschland eingehen: Es wird angenommen, dass heute die Hälfte aller Menschen, die sich das Leben nehmen, an Depressionen leiden, 2010 etwa 7.000 [4]. Damit ist eine depressive Erkrankung eine der häufigsten „Todesursachen“ in Deutschland. Wenn wir für 2016 eine vergleichbare Zahl an Suiziden in Folge von Depression annehmen, dann war es damit letztes Jahr übrigens 400 Mal wahrscheinlicher in Folge einer Depression zu sterben als bei einem Terroranschlag.
Die Relevanz dieser Zahlen möchte ich zunächst in der Hinsicht politisieren, dass ich nicht von einer „neutralen“, „natürlichen“ oder „überzeitlichen“ Krankheit spreche, nicht von „der Depression“ überhaupt, sondern von der ganz spezifischen depressiven Erkrankung im Spätkapitalismus. An dieser Stelle scheint es mir unumgänglich auf einige Konzepte der kapitalismuskritischen Theoriebildung – insbesondere der im Frankreich der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – (sehr) kursorisch einzugehen, die den Wandel von Produktionsbedingungen, Ideologien und Subjektierungsweisen im neoliberalen Kapitalismus beschreiben.
Den Wechsel vom „fordistischen“ zum „postfordistischen“ Produktionsmodell des Kapitalismus beschreibt Deleuze in Anschluss an Foucault und Hinblick auf „die Regierung von Individuen“ mit dem Übergang von „Disziplinar- zur Kontrollgesellschaften:
Die Kontrollgesellschaften sind dabei die Disziplinargesellschaften abzulösen. ‚Kontrolle‘ ist der Name, den Burroughs vorschlägt, um das neue Monster zu bezeichnen, in dem Foucault unsere nahe Zukunft erkennt. Auch Paul Virilo analysiert permanent die ultra-schnellen Kontrollformen mit freiheitlichem Aussehen, die die alten – noch innerhalb der Dauer eines geschlossenen Systems operierenden – Disziplinierungen ersetzen. [5]
In dem kurzen aber vielrezipierten Text geht Deleuze auch auf die veränderten Produktionsbedingungen des Kapitalismus ein:
In der aktuellen Situation ist der Kapitalismus [in den Zentren] jedoch nicht mehr an der Produktion orientiert, die er oft in die Peripherie der Dritten Welt auslagert […] Dieser Kapitalismus ist nicht mehr für die Produktion da, sondern für das Produkt, das heißt Verkauf oder Markt. Daher ist sein wesentliches Merkmal die Streuung, und die Fabrik hat dem Unternehmen Platz gemacht. Familie, Schule, Armee, Fabrik sind keine unterschiedlichen analogen Milieus mehr, die auf einen Eigentümer konvergieren, Staat oder private Macht, sondern sind chiffrierte, deformierbare und transformierbare Figuren ein und desselben Unternehmens, das nur noch Geschäftsführer kennt. [6]
Die Krise der alten Zentralinstitutionen des Kapitalismus fordistischer Prägung „Familie, Schule, Armee, Fabrik“ wird in der Weise aufgelöst, dass das Paradigma des „Einschlusses“ auf die Peripherie ausgelagert wird und in den Zentren neue Produktionsweisen entstehen, die gerade auf die „Freisetzung“ des Individuums angewiesen sind. Die Frage, ob dieser Wandel eher „marxistisch“ mit der Veränderung von Produktionsverhältnissen oder eher „poststrukturalistisch“ mit der Veränderung von Dispositiven aus Praktiken, Mechanismen und Strategien von Macht- und Wissensverhältnissen zu erklären ist, kann ich (an dieser Stelle) nicht beantworten, sie scheint aber durchaus von Bedeutung und soll im Praxisteil zumindest ansatzweise verhandelt werden.
Die ideologische Rückendeckung des Wandels in der Produktionsweise hin zum „creative capital“ arbeiten Boltanski und Chiapello in ihrer – mittlerweile als einschlägig anzusehenden – Studie zum „neuen Geist des Kapitalismus“ heraus. Ihre zentrale Fragestellung lautet, wie eine Lebensform beschaffen sein muss, um den Anforderungen der gegenwärtigen Akkumulationsregime des Kapitalismus gerecht zu werden und diese (zumindest passiv) zu bejahen. In Bezug auf den historischen Wandeln argumentierte die Autor*innen, dass es dem kapitalistischen Geist möglich war bestimmte Aspekte der Kapitalismuskritik, insbesondere solcher der „Künstler*innenkritik“ aufzunehmen, umzuwandeln und zu neutralisieren:
In gleicher Weise lässt sich nun die Entwicklung des flexiblen Neo-Kapitalismus als das Ergebnis der aufgrund wirtschaftlicher Interessen stattfinden Kooperation von Elementen der ’Künstler*innenkritik’ betrachten (Individualisierung der Bewertung von Leistungen und von Karrieren, Reduzierung direkter hierarchischer Kontrolle usw.). Diese Kooption galt den Arbeitgebern als realistische Strategie zur Bewältigung der Verwaltungskrise in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. [7]
Entscheidende ideologische Fragmente, wie die Forderungen nach mehr Kreativität und Autonomie, konnte sozusagen aus dem kritischen Block der 68er-Konstellation herausgebrochen und von der Kapitalseite re-absorbiert werden:
Die Inkorporation von Themen der ’Künstler*innenkritik’ in den kapitalistischen Diskurs ist inzwischen nur zu offensichtlich. Die Managementliteratur wird nicht müde zu erklären, dass Lohnarbeiter*innen mit den Veränderungen der Arbeitswelt zwar ihre Arbeitsplatzsicherheit verloren haben mögen, dafür aber heute kreativere, abwechslungsreichere und autonomere Tätigkeiten ausführen, die eine größere Nähe zur Lebensform der Künstler*innen aufweisen. [8]
Ich möchte hier nicht auf die von Boltanski und Chiapello diagnostizierte Dialektik von Kapitalismus und Kritik und deren Probleme eingehen, sondern viel eher die sozial-psychologischen Auswirken auf „das Individuum“ näher betrachten.
Die Ausbreitung des „Autonomieparadigmas“ in kapitalistischer Ausbuchstabierung ist gerade die Bedingung für das Auftauchen der Depression als gesellschaftlich zentrale Krankheit, jene das „Abfallprodukt“ der individualisierten Leistungsgesellschaft. Der französische Soziologe Alain Ehrenberg diagnostiziert in dieser Hinsicht den von Deleuze beschriebenen Übergang zu „Kontrollgesellschaften“ mit den ideologischen Inhalten des „neuen Geist des Kapitalismus“ auch als Auftauchen eines neuen Typs von Individuen:
Die Geschichte der Depression verläuft parallel zum Niedergang jenes Typus disziplinierter Individuen, der das Erbe des späten 19. Jahrhunderts gewesen ist und der sich bis in die 1950er und 1960er Jahre erhalten hat. […] Schrittweise wurde eine auf Disziplin, mechanischen Gehorsam, Konformität und Verboten gründende Gesellschaft durch eine Gesellschaft verdrängt, die auf Autonomie, das heißt persönliche Leistung, Wahlfreiheit, Eigenverantwortung und die Initiative des Einzelnen setzt. [9]
Die Absorption und Neuausrichtung des Autonomiegedanken, weg von einer politischen Forderung, hin zu einer Verantwortlichmachung des Individuums und Verpflichtung zur kreativen Eigenleistung bringt eine ganz neue Anforderung an die Einzelnen hervor. Die Kehrseite dieser Anforderungen besteht in Überforderungen, Instabilität und Einsamkeit. Laut Ehrenberg löst die Depression analog zum Wandel von den „Disziplinar- zu den Kontrollgesellschaften“ deswegen die Neurose als zentrale Krankheit der Zeit ab:
Wenn nach Freud die Neurose die eine Krankheit der Schuld ist, dann scheint die Depression als Krankheit der Verantwortlichkeit zu sein, hier herrscht gegenüber dem Schuldgefühl ein Gefühl des Ungenügens vor. Die Depression, als deren Hauptmerkmal man einen Verlust an Selbstachtung ausmachen kann, ist eine Pathologie der Größe: die deprimierte Person ist der Aufgabe der Selbstwerdung nicht gewachsen; sie zermürbt sie vielmehr. [10]
Die Ausweitung der ideologischen Formation des neuen Geist des Kapitalismus von der Arbeitswelt auf alle Bereiche des Lebens konstituiert den hyper-individualverantworlichen Mensch und die depressive Krankheit. Entgegen der Formulierung von Ehrenberg, dass die Depression eine Pathologie der Größe sei, in der die deprimierten Personen der Aufgabe der Selbstwerdung (an sich) nicht gewachsen sind, halte ich es für ebenso zentral, ob und in welcher Weise „potentiell deprimierte Personen“ im Kapitalismus Erfahrungen von Zuneigung, Vertrauen oder Solidarität machen können. Das gegenwärtige Phänomen der Depression ist meines Erachtens keine anthropologische Grundreaktion auf zu viel „Freiheit“, sondern viel eher eine spezifisch Reaktion auf zu viel „Individualverantwortung, Leistungsdruck und Abstiegsängste“ bei einer gleichzeitigen Schwäche von verbindenden Kämpfen gegen übermächtig erscheinende Unterdrückungsverhältnisse..
Zusammengefasst korrelieren das Auftauchen des „neuen Geist des Kapitalismus“ und das des hyper-verantwortlichen Individuums mit der Depression als spezifisch kapitalistische Krankheit. Der Wandel von Ideologie und Menschen tritt allerdings nicht ex nihilo als Veränderung des Bewusstseins auf, in einer Gesellschaft, die nun „freier“ andere Ideale und Ziele formuliert – wie das Ehrenberg zu suggerieren scheint –, sondern auch als Produkt anderer (Re-)Produktionsbedingungen (in den kapitalistischen Zentren). Das heißt schließlich, dass auch (und gerade) in meiner „individuellsten“ Krankheitserfahrung im Bewusstsein das gesellschaftliche Signum der Zeit als materiales Kräfteverhältnis liegt. Und ich muss nicht erst die von Mark Fisher so akkurat beschrieben depressive Stimme in meinem Kopf hören, die mir sagt, dass ich die Miete für mein Zimmer eigentlich nicht bezahlen kann und ich es nicht verdiene, innerhalb des Berliner Innenstadtrings zu wohnen, um mich daran zu erinnern, dass mein Erleben auch der vermittelte Ausdruck der Krisenerscheinungen des Kapitalismus ist.
Die politische Perspektive
Ich möchte mich bei euch bedanken, wenn ihr den Text bis hierhin gelesen habt, insbesondere wenn ihr selbst gerade depressive Phase erlebt und/oder ihr aus verschiedenen Gründen der Unterdrückung einen schwierigen Zugang zu dominierenden Formen der sozialtheoretischen Abstraktionsmodelle habt. Für mich war der Text von Mark Fisher auch deswegen so ansprechend, weil er auf einer basalen Ebene depressive Erfahrungen mit gesellschaftsanalytischen Hintergründen verbinden konnte.
Ich denke, dass in dieser Abstraktion und Distanznahme der eigenen Krankheitserfahrungen ein anti-individualisierendes Potential steckt, dass es schaffen kann sich auch in depressiven Phase einigermaßen „okay“ zu fühlen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich bei der ersten richtigen Zuspitzung einer depressiven Phase fast wahnsinnig geworden wäre, weil ich die „depressive Stimme“ nicht als Ausdruck von gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse sondern als mich selbst wahrgenommen hatte . Natürlich wird es immer wieder Momente geben, in denen Schmerzen und Erschöpfung die endlose Spirale aus Existenzängsten, Schamgefühlen und Suizidgedanken auszulösen und alles andere überlagen. Aber ich bin davon überzeugt, dass in der Auseinandersetzung mit der eigenen Depression als gesellschaftliches Verhältnis eine Möglichkeit liegt, sich immer wieder von seinen depressiven Gedanken zu distanzieren und den Kampf um eine Verbesserung aufzunehmen.
Dieser Kampf ist aus der Logik der Depression heraus zunächst ein individualisierter, mithin schlicht einer um basale vitale Funktionen, aber auch einer der kollektiviert werden kann, in gemeinsamer Reflexion und Austausch von Erfahrungen ebenso wie in Auseinandersetzung um Pflegeeinrichtungen und Therapiemöglichkeiten, Forschungsgeldern und gesellschaftlicher Anerkennung. Wie bei fast jedem gesellschaftlichen Konflikt muss die von Leid und Ausgrenzung betroffene Seite ihre Vereinzelung überwinden, kollektive Sprechfähigkeit erlangen und zur Änderung der Gesellschaft auch deren materielle Grundlagen verändern. Ich denke, dass eine besondere Sensibilität gegenüber Depressiven und deren Bedürfnissen sehr wichtig ist, dass sie besondere Zuwendung brauchen dürfen, ohne sich deswegen schämen zu müssen, und auch ein Recht auf Rückzug und Freiräume haben. Diese in Mangel eines besseren Wortes „identy depression politics“ würde ich als wichtigen Schritt der Auseinandersetzung ansehen (um das Problem überhaupt bewusst zu machen), der allerdings zugleich mit dem allgemeinen Prinzip der Bedürfnisorientierung verbunden werden sollte.
Ich hielte es für unzureichend, nur eine „depressive Internationale“ aufzurufen, die in teilweise radikalen Kämpfen das Problem der Depression gesellschaftlich vermittelt und in Lobbyarbeit die Lebensbedingungen für Depressive verbessert. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass diese Arbeit nicht absolut lebensentscheidend sein kann: Ich war nur einmal kurz in einer klinischen Einrichtung und verstehe die unmittelbare Wichtigkeit einer politischen Praxis im Feld der Anti-Psychiatrie [12]. Worauf ich hier viel eher hinaus möchte, ist die soziale Situiertheit von depressiven Personen. Jede*r kann von Depressionen betroffen sein, aber ich vermute, dass Depressionen mit anderen Formen von sozialem Ausschluss, Unterdrückung und Schamerlebnissen korrelieren und in ohnehin schon von Erniedrigungen betroffenen Milieus häufiger auftreten. Außerdem sind die Depressionen von „Papierlosen*“ nicht mit der von Staatsbürger*innen identisch oder die von Nicht-Cis-Personen mit der von Männern. Es muss unglaublich schlimm sein, ohnehin schon mit all seinen Erfahrungen im Widerspruch zur gesellschaftlichen Norm zu stehen, unter Ausbeutungsverhältnissen zu leiden, keinen Zugang zur medizinischen Versorgung zu haben, und sich gleichzeitig in der Depression für all das vielfach schuldig und „zu schlecht für alles“ fühlen.
Ich vermute weitergehend, dass trotz aller Heterogenität der Depressionserfahrungen, die von mir im zweiten Teil herausstellte spezifisch kapitalistische Depression strukturell für die Zurichtung des arbeitenden Subjekts charakteristisch ist. In marxistischem Vokabular sind Depressive Produktivkräfte, die mit den Produktionsbedingungen in einem unversöhnlichen Konflikt gegenüber stehen – und kein*e von Burnout betroffene*r Bourgeois* können jemals die existenzielle Angst einer drohenden „Lumpenproletarisierung“ nachempfinden. Entgegen der „marxistischen Hoffnungen“, sind Depressive allerdings Produktivkräfte, die nicht nur von den Produktionsbedingungen, sondern auch von ihrer eigenen Arbeitskraft entfremdet sind – hierin vollendet sich sozusagen die Abhängigkeit der Arbeiter*innen von den Arbeitsbedingungen. Weil diese zum Teil weiter in das arbeitende Subjekt „hinein“ verlegt werden konnten, ist eine antagonistische Klassenauseinandersetzung ungleich schwieriger. Die depressive Person ist ein*e passivierte*r Arbeiter*in: die depressive Person streikt nicht, sie ist krankgeschrieben, die depressive Person spricht nicht, sie leidet.
Hat damit lediglich der „Produkutionsprozess“ eine Möglichkeit erhalten, Arbeiter*innen durch ein Dispositiv von psychosozialem Druck gefügsam zu machen? Ich denke nicht. Ich vermute, dass die Leiderfahrungen von Depressiven ebenso neue Wege von radikalen Gesellschaftskritik und grenzenloser Solidarität ermöglichen können. Ich denke, dass die Erfahrung ein zutiefst verletzliches, leidendes, entfremdetes und individuiertes Wesen zu sein, viel dazu beitragen kann sich zu politisieren und sich anders und fürsorglicher mit den Problemen von Anderen zu beschäftigen. Ich denke weder, dass es darin eine Notwendigkeit gibt, noch von Depressionen betroffene Menschen ein kommendes revolutionäres Subjekt konstituieren. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass Depressionen als gesellschaftliches Phänomen eine zunehmend wichtige Bedeutung spielen werden und es wichtig ist, Depressionen auch als Klassenfrage zu politisieren. In Deutschland waren 2009 schätzungsweise vier Millionen Menschen von einer depressiven Erkrankung betroffen – das sindweit mehr als in allen politischen Parteien zusammengenommen organisiert sind. Auf einer persönlichen Ebene würde ich mir auch wünschen, mehr Texte von Menschen zu lesen, die sich mit revolutionärer Theorie und Praxis beschäftigen und sich gleichzeitig mit depressiven Erkrankungen auseinandersetzen, im Sinne einer „Verständigung“ über „eine Ethik von depressiven Revolutionäre*innen“.
Die Einschränkungen des depressiven Lebens und die Scham davor machen vor der Arbeit als politisches Subjekt nicht halt. Das Gefühl der Unzulänglichkeit „eigentlich gar keine politische Arbeit machen zu können“ stellt sich beispielsweise bei mir ebenso ein wie der Eindruck für meine Genoss*innen, „nur eine Last“ zu sein. Ich sage das als Aktivist, dem politische Arbeit auf einer grundlegenden Ebene sehr viel Kraft und Zuversicht gibt. . Es ist mir vollkommen klar, dass auch revolutionäre Organisationen den gleichen Machtverhältnisse und Entfremdungsprozessen unterliegen wie die Gesellschaft selbst,es kein „einfaches Außen“ gibt, sondern dieses immanent erkämpft werden muss. Aber ich denke nicht, dass eine kapitalismuskritische Organisation sich als Selbsthilfegruppe verstehen sollte oder sich für gute Praxis mit den „schlimmsten Leiderfahrungen“ auseinandersetzen müsste.
Viel eher müsste es um einen Modus des Sprechen-Könnens über Verletzlichkeit und Bedürfnisse gehen, welches in die politische Arbeit integriert werden kann.Allgemeiner gilt es die Fragen nach dem „Einschluss der Ausgeschlossen“ auch in der eigenen Organisation immer mit zu stellen, wobei beispielsweise die Inklusion von „Papierlosen*“ – so unvollständig das mit Unterstützer*innenkreisen auch sein mag – als einen unglaublicher Fortschritt angesehen werden kann. Deswegen ist es wichtig nach den Voraussetzungen für politisches Handeln zu fragen und für revolutionäre Politik intrinsisch auch verschiede Modelle der Partizipation zu entwickeln, insbesondere für Gruppen, denen es um die Veränderung aller gesellschaftlicher (Re-)Produktionsverhältnisse geht, und die potentiell Mehrheiten organisieren wollen. Wie ist die Teilnahme als Eltern möglich, als behinderte Person, als Person mit ganz anderen Bedürfnissen?
Zuletzt ist es dabei zentral, Modi der Intersubjektivität zu erproben, die das Sprechen über Bedürfnisse und Erfahrungen von grenzenloser Solidarität und kollektiver Autonomie ermöglichen, um schließlich auch die Frage nach dem „subjektiv-revolutionären“ des „revolutionären Subjekts“ aufzuwerfen. Inwiefern gehe ich auf andere ein und habe nicht nur teil an internen Hegemoniekämpfen für die Aneignung von materiellen (Re-)Produktionsbedingungen, sondern arbeite auch in den internen Auseinandersetzungen auf eine ganze andere gesellschaftliche Praxis hin?
Die Fragen gelten auch über die eigene Organisierung hinaus: Wie finde ich eine gute Praxis mit (ganz) anderen solidarisch umzugehen, die nicht das leisten können, was ich leisten kann, die Kriegstraumata durchlitten haben, die unter Angstzuständen leiden, die an dieser Gesellschaft kaputt gehen? Diese Fragestellungen ergeben sich nicht nur aus einer depressiven Perspektive, und können natürlich auch nicht von dort aus beantworten werden. Ich glaube aber, dass es etwas Wunderbares wäre, mit seinen Genoss*innen das Leistungsparadigma in all seinen Facetten zu demolieren, sich in seiner Sprachlosigkeit zu unterstützen und auch in sozialen Relationen auf den Bruch oder die Brüche mit allen gesellschaftlichen Verhaltensweisen zu orientieren, in denen Menschen geknechtet, erniedrigt und deprimiert werden.
Endnoten
[1] Es handelt sich bei diesem Text weder um einen Nachruf noch um eine Theoretisierung, die Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebt. Vielmehr stellt es einen Versuch da sich mit der eigenen Verfasstheit, der hyperindividualisierten Depressionserfahrung und deren sozialer Bedingtheit, auseinanderzusetzen. In Zeiten, in denen ich nicht gesprochen haben werden kann, werden mir immer die Texte von anderen helfen, die eigene Sprachlosigkeit zu überbrücken. Mark Fisher hat dafür ein eindrückliches Beispiel gegeben, sein Text ist „good for something“.
[2] https://theoccupiedtimes.org/?p=12841, Original auf Englisch: „Depression is partly constituted by a sneering ‘inner’ voice which accuses you of self-indulgence – you aren’t depressed, you’re just feeling sorry for yourself, pull yourself together – and this voice is liable to be triggered by going public about the condition. Of course, this voice isn’t an ‘inner’ voice at all – it is the internalised expression of actual social forces, some of which have a vested interest in denying any connection between depression and politics. My depression was always tied up with the conviction that I was literally good for nothing.“
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Depression, darin: „Depressive Erkrankungen gehen gelegentlich mit körperlichen Symptomen einher, sogenannten Vitalstörungen, Schmerzen in ganz unterschiedlichen Körperregionen, am typischsten mit einem quälenden Druckgefühl auf der Brust. Während einer depressiven Episode ist die Infektionsanfälligkeit erhöht. Beobachtet wird auch sozialer Rückzug, das Denken ist verlangsamt (Denkhemmung), sinnloses Gedankenkreisen (Grübelzwang), Störungen des Zeitempfindens. Häufig bestehen Reizbarkeit und Ängstlichkeit. Hinzukommen kann eine Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen.“
[4] Ebd.
[5] Deleuze, Postskiptum über die Kontrollgesellschaften, S. 14. In: Christoph Menke/ Juliane Rebentisch (Hrsg), Kreation und Depression. Freiheiten im gegenwärtigen Kapitalismus. Frankfurt 2012.
[6] Ebd.
[7] Chiapello, Evolution und Kooption, S. 49. In: Christoph Menke/ Juliane Rebentisch (Hrsg), Kreation und Depression. Freiheiten im gegenwärtigen Kapitalismus. Frankfurt 2012.
[8] Ebd.
[9] Ehrenberg, Depression: Unbehagen in der Kultur oder neue Formen der Sozialität, S. 53. In: Christoph Menke/ Juliane Rebentisch (Hrsg), Kreation und Depression. Freiheiten im gegenwärtigen Kapitalismus. Frankfurt 2012.
[10] Ebd., S. 54.
[11] In „einblogvonvielen“ wird Psychiatrie beispielsweise folgendermaßen definiert: „die Psychiatrie ist meiner Ansicht nach ein Mittel der Gesellschaft ™ um Gewalt an Menschen auszuüben, die bereits diskriminiert und exkludiert sind. Die Mittel der Psychiatrie, Macht und ergo Gewalt auszuüben sind meiner Meinung nach Stigmatisierung, Deutungshoheit/ Definitionsmacht, die legalisierte Vergiftung mit Psychopharmaka und die Beschneidung der Grundrechte von sogenannten Erkrankten.
Diese Institution und ihr Machtbereich, wird von mir radikal kritisiert und lässt keine Ausnahmen zu, da ich die Gesellschaft ™ in der Pflicht sehe, sich mit allen Menschen in ihr ohne Gewalt oder der Drohung dazu, auseinanderzusetzen.“, siehe https://einblogvonvielen.org/faq/







