Feminismus, Intersektionalität und Marxismus: Debatten über Geschlecht, „race“ und Klasse
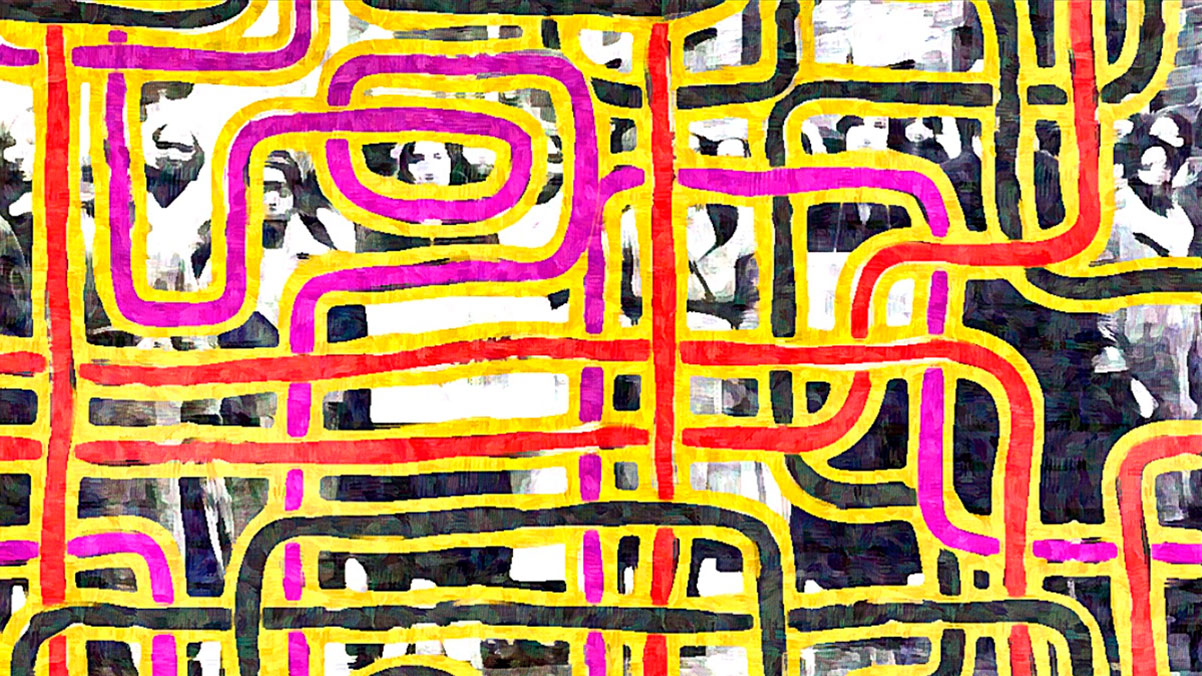
Was sagt Intersektionalität über die Ursachen der sich überschneidenden Unterdrückungen und vor allem über Wege der Emanzipation aus?
Intersektionalität ist in der Wissenschaft, im feministischen Aktivismus und in sozialen Bewegungen ein häufig gebrauchtes Wort. Terry Eagleton stellte fest, dass „Klasse, ,race‘ und Geschlecht“ die „heilige Dreifaltigkeit“ zeitgenössischer Theorie darstellten1. Doch ist oft nicht klar, was Intersektionalität eigentlich ausmacht, wenn von ihr gesprochen wird. Handelt es sich um eine Theorie oder eine empirische Beschreibung? Wirkt Intersektionalität im Rahmen der individuellen Subjektivität oder analysiert sie Systeme der Dominanz? Und: Was sagt sie über die Ursachen der sich überschneidenden Unterdrückungen und vor allem über Wege der Emanzipation aus?
Obwohl Überlegungen zum Verhältnis von Geschlecht, „race“2 und Klasse bereits lange zuvor in den Debatten des Marxismus und der Linken existierten, wurde der Begriff der Intersektionalität erstmals in einem 1989 von der Schwarzen Juristin und Feministin Kimberlé Crenshaw3 veröffentlichten Artikel als ein Konzept definiert. Sie wollte damit eine Antwort auf diese Beziehung im Bereich des Antidiskriminierungsrechts in den Vereinigten Staaten geben. Ein Ausgangspunkt, der zweifellos die Grundzüge des Konzepts prägte, wie wir später sehen werden. Sein wichtigstes Vorbild sind jedoch die Ausführungen Schwarzer Feministinnen der 1970er Jahre, wie z. B. des Combahee River Collective, die im Rahmen der zweiten Welle des Feminismus und der politischen Radikalisierung der damaligen Zeit eine „intersektionale“ Kritik an Befreiungsbewegungen erhoben haben.
In diesem Artikel geben wir einen kurzen Überblick über die Entstehungsgeschichte, die ersten Ansätze des Konzepts, seine Verschiebung im Zuge des Aufstiegs des Postmodernismus und die Debatte, die sich aus sozialen Bewegungen heute ergibt. Gleichzeitig setzen wir ausgehend vom Marxismus einen kritischen Kontrapunkt zu den Intersektionalitätstheorien.
1. Das Combahee River Collective und die Schwarzen Feministinnen
Im Jahr 1977 wurde das Manifest des Combahee River Collective veröffentlicht. Der Name war eine Hommage an die mutige Militäraktion, die die Ex-Sklavin und Abolitionistin (Kämpferin gegen die Sklaverei, A.d.Ü.) Harriet Tubman im Jahr 1863 angeführt hatte, bei der 750 Sklav*innen trotz feindlichen Kanonenfeuers befreit wurden. Sie war die einzige Frau, die während des amerikanischen Bürger*innenkriegs eine Armeeeinheit führte.
Schwarze Feministinnen der 1970er Jahre verstanden sich als Teil einer historischen Tradition des Kampfes der Schwarzen Frauen seit dem 19. Jahrhundert. In ihrem Buch Women, Race and Class4 bekräftigt Angela Davis ihre Rolle in der abolitionistischen Bewegung in den Vereinigten Staaten. Sojourner Truth ging mit ihrer Rede auf der Frauenrechtskonferenz in Ohio 1851 in die Geschichte ein. Ein Mann hatte argumentiert, dass Frauen nicht wählen sollten, weil sie das „schwächere Geschlecht“ seien, worauf Sojourner Truth entschieden reagierte:
Ich habe gepflügt, gepflanzt und die Ernte eingebracht, und kein Mann hat mir gesagt, was zu tun war! Bin ich etwa keine Frau? Ich konnte so viel arbeiten und so viel essen wie ein Mann wenn ich genug bekam – und die Peitsche konnte ich genauso gut ertragen! Bin ich etwa keine Frau? Ich habe dreizehn Kinder geboren und erlebt, wie die meisten von ihnen in die Versklavung verkauft wurden […]. Bin ich etwa keine Frau?
Ihre Antwort forderte das patriarchale Narrativ heraus, das „Weiblichkeit“ konstruierte und Frauen als schwache Wesen darstellte, die „natürlich“ minderwertig und unfähig seien, die politische Staatsbürger*innenschaft auszuüben. Aber es war auch eine Infragestellung der weißen Suffragetten, da viele von ihnen die Forderungen der Schwarzen Frauen und der arbeitenden Frauen außen vor ließen.
Mitte der 70er Jahre beschlossen mehrere Schwarze Frauen, diese Tradition wieder aufzunehmen und militante Gruppen zu gründen, nachdem sie schlechte Erfahrungen in der weißen feministischen Bewegung und in Organisationen zur Befreiung Schwarzer Menschen gemacht hatten. Mit der Veröffentlichung des Manifests des Combahee River Collective stellten Schwarze Feministinnen gleichzeitig den weißen Feminismus, die Schwarze Bewegung und den bürgerlichen Schwarzen Feminismus der NBFO (National Black Feminist Organization) infrage.
Ausgangspunkt stellte die gemeinsame Erfahrung einer Gleichzeitigkeit von Unterdrückungen dar – die Triade von Klasse, „race“ und Geschlecht, zu der auch die Unterdrückung aufgrund der sexuellen Orientierung kam. Aus dieser Position heraus übten sie eine Kritik an der feministischen Bewegung, in der der Radikalfeminismus hegemonial war. Diese Strömung interpretierte soziale Widersprüche durch den Gegensatz zwischen „sexuellen Klassen“5 und räumte einem Dominanzsystem – dem Patriarchat – absolute Priorität gegenüber allen anderen ein6. Mit der Infragestellung der Vorrangstellung der Unterdrückung aufgrund von Geschlecht oder Sexualität gegenüber Rassismus und Ausbeutung setzten sich die Schwarzen Feministinnen auch mit den Strömungen auseinander, die offen separatistisch waren oder einen „Krieg der Geschlechter“ ausriefen. Diese Strömungen, die im Feminismus der späten 1970er Jahre erstarkt waren, definierten sie als eine von den Interessen der weißen bürgerlichen Frauen geführte Bewegung. Sie argumentierten auch, dass jede Art von biologistischer Determinierung der Identität zu reaktionären Positionen führen könne.
Auch wenn wir Feministinnen und Lesben sind, sind wir solidarisch mit progressiven Schwarzen Männern und setzen uns nicht für eine vonweißenSeparatistinnen geforderte Abspaltung ein.7
In ihrem Buch Feminism is for everybody argumentiert die Schwarze Feministin bell hooks, dass durch Debatten um Rassismus und Ausbeutung „utopische Visionen der Schwesternschaft“ und die ahistorische Definition von Patriarchat infrage gestellt wurden. Sie bilanziert, dass „die weißen Frauen, die versucht haben, die Bewegung um die Idee der gemeinsamen Unterdrückung herum zu organisieren und die vorgeschlagen haben, dass Frauen eine sexuelle Klasse oder Kaste bilden, sich am meisten wehrten, Unterschiede zwischen Frauen zuzugeben“. Die Polemik mit separatistischen Strömungen innerhalb der Bewegung wird auch hier deutlich:
Sie porträtierten alle Männer als Feind, um alle Frauen als Opfer zu repräsentieren. Die Fokussierung auf Männer lenkte die Aufmerksamkeit von den Klassenprivilegien einiger feministischer Aktivistinnen ab, ebenso wie von ihrem Wunsch, ihre Klassenmacht zu erweitern.
Im CRC-Manifest war der Kampf für die Emanzipation der Schwarzen Frauen und der Schwarzen Bevölkerung vom Kampf gegen das kapitalistische System nicht zu trennen. Deshalb haben sie sich ausdrücklich am Kampf für den Sozialismus beteiligt:
Uns ist bewusst, dass die Befreiung aller unterdrückten Völker sowohl die Zerstörung der politisch-wirtschaftlichen Systeme des Kapitalismus und Imperialismus als auch die Zerstörung des Patriarchats erfordert. Wir sind Sozialistinnen, weil wir glauben, dass die Arbeit für den kollektiven Nutzen derjenigen strukturiert sein sollte, die Arbeit leisten und die Produkte herstellen […]. Allerdings sind wir nicht davon überzeugt, dass eine sozialistische Revolution, die nicht auch eine feministische und anti-rassistische Revolution ist, unsere Befreiung gewährleisten wird.
In Bezug auf den Marxismus haben sie erklärt, dass sie grundsätzlich mit Marx‘ Theorie über „die spezifischen wirtschaftlichen Zusammenhänge“ übereinstimmen, aber der Ansicht sind, dass die Analyse „weiter ausgebaut werden [muss], um unsere spezifische wirtschaftliche Situation als Schwarze Frauen verständlich machen zu können“. Es sei darauf hingewiesen, dass sie zwar die Notwendigkeit einer sozialistischen Revolution benannten, sich die praktischen Aufgaben, die sie als Gruppe vorschlugen, jedoch hauptsächlich auf Selbsterfahrungsworkshops und den Kampf für konkrete Rechte Schwarzer Frauen in den Nachbarschaften beschränkten.
Im Manifest erscheint der Begriff der Identitätspolitik als Antwort auf die spezifische Art und Weise, wie Schwarze Frauen Unterdrückung erfahren. Die Erkennung der eigenen Identität wird als notwendiges Moment hervorgehoben, um sich in der Folge mit anderen Befreiungsbewegungen zusammenzuschließen. Es bestand also eine Spannung zwischen der Bildung einer differenzierten Identität und dem Zusammenschluss mit anderen Unterdrückten für den Kampf gegen ein System, das Formen der ökonomischen, sexistischen und rassistischen Herrschaft kombiniert.
Einige Jahre später, als sich der soziale, politische und ideologische Kontext mit dem Aufkommen des Neoliberalismus und des Postmodernismus drastisch veränderte, bekam das Konzept der Intersektionalität eine neue Bedeutung. Die radikale Transformation der Gesellschaft war nicht mehr an der Tagesordnung, der Moment des kollektiven Handelns löste sich allmählich auf. Die Verbreitung differenzierter „Identitäten“ und die Forderung nach einer Politik der Anerkennung innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft gewannen an Gewicht.
2. Intersektionalität als Kategorie der Diskriminierung
Kimberlé Crenshaw definierte erstmals 1989 das Konzept der Intersektionalität. Sie wies damals darauf hin, dass die getrennte Behandlung von rassistischer und sexistischer Diskriminierung als „sich gegenseitig ausschließende Erfahrungs- und Analysekategorien“ problematische Folgen für die Rechtswissenschaft, die feministische Theorie und die antirassistische Politik habe. Aus diesem Grund schlug sie vor, „die Multidimensionalität der Erfahrung Schwarzer Frauen mit dem eindimensionalen Analyserahmen, der diese Erfahrungen verzerrt, in Kontrast zu setzen“.
Sie wies damit darauf hin, dass jede Konzeptualisierung, die auf einer eindimensionalen Achse der Diskriminierung (sei es aufgrund von „race“, Geschlecht, Sexualität oder Klasse) basiert, Schwarze Frauen von der Möglichkeit, sich darin wiederzuerkennen und Diskriminierung zu bekämpfen, ausgrenzt und die Analyse auf die Erfahrungen von privilegierten Mitgliedern jeder Gruppe beschränkt. Das heißt: Rassismus wird tendenziell aus der Sicht von Schwarzen mit Geschlechts- oder Klassenprivilegien gesehen und bei Sexismus liegt der Schwerpunkt auf weißen Frauen mit wirtschaftlichen Ressourcen. „Da die intersektionale Erfahrung mehr ist als die Summe von Rassismus und Sexismus, kann keine Analyse, die Intersektionalität ausspart, den spezifischen Prozess, der Schwarze Frauen unterordnet, angemessen adressieren.“
In ihrer Analyse untersucht Crenshaw, wie mehrere Klagen Schwarzer Frauen von der Justiz abgelehnt wurden. Einer der Fälle, die sie analysiert, ist DeGraffenreid vs. General Motors (GM). Fünf Frauen verklagten den multinationalen Konzern, dem sie Diskriminierung am Arbeitsplatz vorwarfen, da sie als Schwarze Frauen nicht in bessere Arbeitsverhältnisse befördert wurden. Das Gericht wies die Klage mit der Begründung ab, dass eine Diskriminierung nicht festgestellt werden könne, weil es sich um „Schwarze Frauen“ handele, die juristisch gesehen keine Gruppe darstellten, die einer besonderen Diskriminierung ausgesetzt sei. Stattdessen willigte es ein, zu untersuchen, ob es zu einer Diskriminierung entlang der Kategorie „race“ oder Geschlecht gekommen war, aber „nicht aufgrund einer Kombination der beiden“. Schließlich stellte das Gericht fest, dass nicht anhand geschlechtsspezifischer Merkmale diskriminiert worden war, da GM Frauen – weiße Frauen – eingestellt hatte. Und weil GM auch Schwarze Menschen – Schwarze Männer – eingestellt hatte, lag der Auffassung des Gerichts zufolge auch keine rassistische Diskriminierung vor. Die Klage der Schwarzen Frauen war nicht erfolgreich. Das Gericht beschied, dass eine Annahme ihrer Klage eine „Büchse der Pandora“ geöffnet hätte.
Crenshaw machte darauf aufmerksam, dass das Ziel von Intersektionalität darin besteht, anzuerkennen, dass Schwarze Frauen auf komplexere Art und Weise Diskriminierung erfahren können und dass ein konzeptionell einseitiger Rahmen es nicht erlaubt, diese zu thematisieren. Ende der 80er Jahre erschien dann das Intersektionalitätskonzept als eine Kategorie, um Diskriminierungserfahrungen zu erfassen – mit dem Ziel, eine neue Rechtsprechung zu etablieren, die es dem Staat ermöglichen würde, „Diversitätspolitik“ zu reglementieren.
Später definierte die US-amerikanische Soziologin und im Bereich des Schwarzen Feminismus Lehrende Patricia Hill Collins Intersektionalität als „eine unverwechselbare Reihe von sozialen Praktiken, die unsere jeweilige Geschichte innerhalb einer einzigen Herrschaftsmatrix begleiten, die durch intersektionale Unterdrückung gekennzeichnet ist“8. In diesem Fall beschreibt Intersektionalität ein Projekt der „sozialen Gerechtigkeit“, das nach Zusammenführungen und Koalitionen mit anderen „Projekten der sozialen Gerechtigkeit“ strebt.
Das Konzept der Intersektionalität wurde dann von vielen anderen Schwarzen, lateinamerikanischen und asiatischen feministischen Intellektuellen im Rahmen der Ausweitung der Frauenforschung in der Wissenschaft weiterentwickelt. Intersektionalität wurde zu einem Modewort auf Kongressen und Symposien; es wurden Forschungsabteilungen und NGOs gegründet, um intersektionale Untersuchungen in den Bereichen Wirtschaft, Recht, Soziologie, Kultur und Verwaltung zu entwickeln. Zur Triade von Geschlecht, „race“ und Klasse kamen weitere Vektoren der Unterdrückung – wie Sexualität, Nationalität, Alter oder Funktionale Diversität – hinzu. Und während somit eine große Sichtbarkeit für die spezifische Situation der mehrfach unterdrückten Gruppen und Communities ermöglicht wurde, geschah diese Entwicklung paradoxerweise im Rahmen eines Klimas der Resignation gegenüber kapitalistischen Gesellschaftsstrukturen, die nun als unmöglich infrage zu stellen wahrgenommen wurden.
3. Intersektionalität, Identitätspolitik und multiple Unterschiede
Der Aufstieg der Intersektionalitätsforschung in der Wissenschaft fällt mit dem Beginn einer neuen historischen Phase zusammen, die das intellektuelle und politische Klima im Neoliberalismus vollständig verändert hat. Die Periode der „bürgerlichen Restauration“9 oder der Hochkonjunktur des Neoliberalismus bedeutete einen generellen Angriff auf die Errungenschaften der Arbeiter*innenklasse weltweit. Die Privatisierungs- und Deregulierungspolitik bahnte sich angesichts des Verrrats der gewerkschaftlichen und politischen Führungen der Arbeiter*innenklasse auf überwältigende Weise den Weg. Dies führte zu einer stärkeren internen Zersplitterung der Arbeiter*innenklasse und zu einem enormen Verlust an Klassensubjektivität.
In diesem neuen Kontext fand eine Verschiebung des Verständnisses von Intersektionalität statt: An die Stelle der Radikalität der Schwarzen und sozialistischen Feministinnen des Combahee River Collective trat angesichts der wachsenden Fragmentierung der Subjekte eine Formulierung der Intersektionalität aus dem Blickwinkel der Postmoderne. Die Idee der Intersektionalität wurde somit derjenigen der „Diversität“ und der „Identitätspolitik“ immer ähnlicher.
Mit dieser Formulierung fand in einem Prozess der „Kulturalisierung“ der Herrschaftsverhältnisse eine Verschiebung vom Kollektiven zum Individuellen und vom Materiellen zum Subjektiven statt. So verfestigte sich die Idee, dass der Kampf der unterdrückten Gruppen grundsätzlich dadurch stattfinde, dass sie ihre eigene Identität erkennen – ein „situiertes Wissen“ konstituieren –, damit die privilegierten Gruppen (Männer, weiße Frauen, heterosexuelle Frauen usw.) ihre Privilegien „dekonstruieren“ und Diversität anerkennen können. Im Rahmen der postmodernen „Kulturwende“ werden Identitäten so dargestellt, als seien sie ausschließlich aus dem Diskurs konstruiert worden, wodurch sich die Möglichkeiten des Widerstandes dann auch nur auf die Ausübung einer alternativen Erzählung beschränken.
Diese Perspektive lässt sich jedoch nicht auf die Frage der Ausbeutung anwenden: Oder kann man von den Besitzer*innen der Produktionsmittel, den Bankiers und Kapitalist*innen erwarten, dass sie ihre Macht durch eine Selbstreflexionsübung „dekonstruieren“? Der Ansatz ist eigentlich auch nicht als Strategie zur Überwindung von Rassismus, Heterosexismus und Machismus geeignet, es sei denn, man würde diese „Herrschaftsachsen“ als voneinander getrennte Einheiten betrachten, die ausschließlich im kulturellen oder ideologischen Bereich Auswirkungen hätten und nicht mit den materiellen und strukturellen Verhältnissen des Kapitalismus verflochten wären.
Zudem führte die Vervielfältigung einer immer umfangreicheren Reihe von unterdrückten Identitäten, ohne die Perspektive einer radikalen Transformation der kapitalistischen Verhältnisse, auf denen diese Unterdrückungen beruhen, zu Praktiken der „Ghettoisierung“ und des Separatismus im Aktivismus. Patricia Hill Collins warnte vor dem Problem:
Es wurde ein Schwerpunkt auf die Akkumulation der Sammlung von unterdrückten Identitäten gelegt, die wiederum zu einer gesamten Hierarchie der Unterdrückung führte. Diese Hierarchie war nicht nur destruktiv, sondern auch spaltend und demobilisierend. (….) Viele Frauen haben sich in eine „Ghetto-Lifestyle-Politik“ zurückgezogen und sehen sich außerstande, sich über individuelle und persönliche Erfahrungen hinaus zu bewegen.10
Die Kehrseite dieser Ohnmacht war, dass sich das kapitalistische System die explosionsartige Ausbreitung der „Diversität“ in Form eines Marktes der Identitäten aneignete. So konnte der Kapitalismus sie soweit assimilieren, wie sie nicht mehr das Gesellschaftssystem als Ganzes in den Blick nahmen. Terry Eagleton wies in Bezug auf die Postmoderne darauf hin, dass
ihre einzige bleibende Errungenschaft – nämlich daß mit ihrer Hilfe Fragen der Sexualität, des Geschlechts oder der Ethnizität so entschieden auf die politische Tagesordnung gesetzt wurden, daß man sich nicht vorstellen kann, wie sie ohne einen enormen Kampf wieder aufgegeben würden – daß diese Leistung lediglich ein Ersatz für eher klassische Formen radikaler Politik war, die sich mit Klasse, Staat, Ideologie, Revolution oder den materiellen Produktionsverhältnissen befaßte11.
In einer Fußnote stellte er jedoch klar, dass es nicht die postmodernen Intellektuellen waren, die diese Themen auf die politische Tagesordnung gesetzt hatten, sondern die ihnen vorangegangenen sozialen Bewegungen in den Kämpfen der 60er und 70er Jahre. Sicher ist, dass, nachdem diese Welle der politischen Radikalisierung gescheitert war, die Aufmerksamkeit zunahm, die die Fragen von Rassismus, Sexismus und Homophobie erregten, während gleichzeitig die Zugehörigkeit zu einer Klasse immer mehr in Vergessenheit geriet (bis zu dem Punkt, dass einige sogar vom Verschwinden der Arbeiter*innenklasse als solche sprachen).
4. Der Rückzug aus der Klassenpolitik
In der Triade von Klasse, „race“ und Geschlecht neigte erstere dazu, aufgelöst oder in eine weitere Identität umgewandelt zu werden, als wäre sie eine Kategorie der sozialen Schichtung (nach Einkommen) oder eine Art ausgeübter Beruf. Marta E. Giménez12 führt aus, dass eines der kennzeichnenden Elemente der Intersektionalitätstheorie die Annahme ist, dass „zur Theoretisierung dieser Zusammenhänge die These der Gleichwertigkeit von Unterdrückungen vertreten werden muss“, was jedoch zur Auslöschung der Besonderheiten des Klassenverhältnisses führt.
Demgegenüber ist es notwendig, zu erläutern, dass „race“, Geschlecht und Klasse eben keine direkt vergleichbaren Kategorien sind. Das bedeutet nicht, Ungerechtigkeiten zu hierarchisieren oder zu bestimmen, welche von größerer Bedeutung für die subjektive Erfahrung der mehrfach Unterdrückten ist; es geht darum, ein besseres Verständnis für das Verhältnis zwischen Unterdrückung und Ausbeutung in einer kapitalistischen Gesellschaft zu schaffen.
So funktionieren beispielsweise Klasse, „race“ und Geschlecht in Bezug auf „Gleichheit“ und „Differenz“ sehr unterschiedlich. Historisch gesehen hat die Bourgeoisie immer versucht, die „soziale Differenz“ der Klasse hinter einer „gleichheitlichen“ Ideologie des „freien Arbeitsverhältnisses“ so weit wie möglich zu verstecken. Doch nutzt sie Rassismus und Sexismus, um „Differenzen“ zu markieren, die biologisch oder „natürlich“ bedingt seien, um Ungleichheiten bei der Verteilung von Ressourcen und beim Zugang zu Rechten zu rechtfertigen, und um das Fortbestehen einer bestimmten Arbeitsteilung oder schlicht und ergreifend die Versklavung und Entmenschlichung von Millionen von Menschen zu verteidigen.
Aus einer emanzipatorischen Sicht sollen keine Unterschiede in Hautfarbe, Geburtsort, biologischem Geschlecht oder sexueller Orientierung als Grundlage für Unterdrückung, Benachteiligung oder Ungleichheit dienen. Gleichzeitig sollen Diversität anerkannt und die Entwicklung des kreativen Potentials aller Individuen im Rahmen der gesellschaftlichen Zusammenarbeit gefördert werden. Aber im Falle von Klassenunterschieden geht es darum, sie als solche zu beseitigen, d.h. dass sie gar nicht mehr existieren. Die Arbeiter*innenklasse strebt durch den Kampf gegen die kapitalistischen Verhältnisse die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln an, was die Abschaffung der Bourgeoisie als Klasse und die Möglichkeit der Abschaffung der gesamten Klassengesellschaft beinhaltet.
Der soziale Unterschied zwischen den Besitzer*innen der Produktionsmittel und denen, die gezwungen sind, ihre Arbeitskräfte gegen ein Gehalt zu verkaufen, strukturiert die kapitalistische Gesellschaft – jenseits aller Versuche, diesen Widerspruch unsichtbar zu machen. Patriarchale Beziehungen – die Jahrtausende vor dem Kapitalismus entstanden sind – und Rassismus sind keine ahistorischen Gebilde, sondern haben im Rahmen der kapitalistischen Verhältnisse neue Formen und einen spezifischen sozialen Inhalt erhalten.
Der Kapitalismus nutzt patriarchale Vorurteile, um mehr als je zuvor eine Trennung zwischen dem „Öffentlichen“ und dem „Privaten“, zwischen dem Produktionsbereich und dem häuslichen Bereich zu etablieren, in dem Frauen – als unsichtbare Arbeit – einen großen Teil der Aufgaben der sozialen Reproduktion der Arbeitskraft übernehmen, die für die Reproduktion des Kapitals notwendig sind. Institutionen wie die Familie, die Ehe oder die Heteronormativität, die unter den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen auch neu definiert wurden, machen diese Rolle für Frauen gesellschaftsfähig und naturalisieren sie. Die vielfältigen Erscheinungsformen der geschlechtsspezifischen Unterdrückung und die quälenden Probleme, die sie für Millionen von Frauen durch Gewalt oder Feminizide mit sich bringen, „reduzieren“ sich nicht auf Klassenverhältnisse, aber sie können auch nicht erklärt werden, ohne die Kategorien von Unterdrückung und Ausbeutung in Beziehung zu setzen.
Rassismus wurde benutzt, um die Versklavung von Millionen von Menschen ideologisch zu rechtfertigen, während die Aufklärung die Ideen von „Freiheit“, „Gleichheit“ und „Brüderlichkeit“ zur Grundlage der „Menschenrechte“ ernannte. Rassismus begleitete und verstärkte das große kolonialistische Vorhaben der imperialistischen Staaten sowie den internen Völkermord – im Falle der USA an indigenen Völkern. In dem Land war und ist Rassismus nach dem Bürger*innenkrieg und der Abschaffung der Sklaverei bis heute der Grund für die Ausgrenzung eines großen Teils der Bevölkerung, der als „Bürger*innen zweiter Klasse“ und „Arbeiter*innen zweiter Klasse“ behandelt wird, was die Spaltung innerhalb der US-amerikanischen Arbeiter*innenklasse vorantreibt. Wie die Schwarzen Feministinnen anprangerten, verbinden sich Rassismus und Sexismus auf meisterhafte Art und Weise, um die kapitalistischen Profite zu maximieren: Es ist ein Fakt, dass die Löhne für Schwarze und lateinamerikanische Arbeiter*innen in den Vereinigten Staaten noch geringer ausfallen, ebenso wie institutionelle und polizeiliche Gewalt gegen Schwarze Jugendliche. Diese Verbindungen kommen im Übrigen wieder auf, um die rassistische und fremdenfeindliche Politik gegen Migrant*innen in Europa, die dort wie Arbeiter*innen zweiter Klasse behandelt werden und keine sozialen und demokratischen Grundrechte haben, zu unterstützen.
5. Marxismus und Intersektionalität
In Das Kapital schrieb Marx: „Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird.“ In einem früheren Werk hatte er – Charles Fourier paraphrasierend – zusammen mit Engels angeführt: „Die Veränderung einer geschichtlichen Epoche läßt sich immer noch aus dem Verhältnis des Fortschritts der Frauen zur Freiheit bestimmen […].Der Grad der weiblichen Emanzipation ist das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation“. Zudem hatte Engels in Die Lage der arbeitenden Klasse in England die Realität der arbeitenden Frauen, die in Massen in die kapitalistische Produktion eingestiegen waren und durch Unterdrückung und Ausbeutung doppelt Ungerechtigkeit erfuhren, konkret analysiert. In Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates nahm Engels die unvollständigen ethnologischen Studien seines Freundes auf, um die historische Entwicklung der Institution Familie und der Unterdrückung von Frauen zu analysieren.
Der revolutionäre Marxismus hat das Verhältnis zwischen Ausbeutung und Unterdrückung aber auch in anderer Hinsicht analysiert. Zum Beispiel, als Marx und Engels darauf hinwiesen, dass das englische Proletariat nicht frei sein könne, solange seine Rechte auf der Unterdrückung der irischen Arbeiter*innen beruhten. Oder später, als Lenin argumentierte, dass ein Volk, das ein anderes Volk unterdrückt, nicht frei sein könne und das Recht auf die Selbstbestimmung der Nationen sowie den Kampf gegen die koloniale Unterdrückung der Völker verteidigte.
In einem kritischen Artikel über die Intersektionalitätstheorie argumentiert Lise Vogel richtigerweise, dass die sozialistischen Feministinnen der 60er und 70er – bereits bevor der Begriff Intersektionalität in Mode kam – die Kreuzung zwischen Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus aufgezeigt hatten. An dieser Stelle muss hinzugefügt werden, dass sich schon lange davor eine bemerkenswerte Tradition des sozialistischen feministischen Denkens entwickelt hatte: von Flora Tristan über Engels und Clara Zetkin, die russischen Revolutionärinnen und viele andere; diese Strömung materialisierte sich in wichtigen internationalen Konferenzen sozialistischer Frauen, in Programmen und Organisationen von Arbeiterinnen und Bäuerinnen. Das von Leo Trotzki geschriebene und 1938 von der Vierten Internationale angenommene Übergangsprogramm erhebt unter anderem das Banner: „Macht den Weg frei für die Jugend! Macht den Weg frei für die werktätigen Frauen!“, um „bei den unterdrücktesten Schichten der Arbeiterklasse (…) Unterstützung (zu) suchen“.
Seitens der Intersektionalitätstheorie wird der Marxismus oft als „klassenreduktionistisch“ kritisiert. Aber die Verteidigung der Zentralität einer „Klassenanalyse“ bedeutet nicht, sie auf die Aktivität der Gewerkschaften in Kämpfen um höhere Löhne zu beschränken. Das wäre eine korporatistische und ökonomistische oder eine sehr syndikalistische Sicht auf Klasse. Es ist wahr, dass die Praxis vieler stalinisierter kommunistischer Parteien und Gewerkschaftsbürokratien im 20. Jahrhundert ein Ausdruck dieser eingeschränkten korporatistischen Politik war, was die Spaltung zwischen „Klassenpolitik“ und dem Kampf der Bewegungen gegen Unterdrückung verschärfte. Aber nur wenn man fälschlicherweise Stalinismus mit Marxismus gleichgesetzt, kann man sagen, dass Marxismus die „Kreuzung“ von Klassenausbeutung und Geschlechterunterdrückung, Rassismus, kolonialer Unterdrückung oder Sexualität nicht betrachtet hat.
Klassenanalyse zielt darauf ab, jene Beziehungen aufzudecken, die die kapitalistische Gesellschaft strukturieren, die auf der allgemeinen Abschöpfung von Mehrwert für die Akkumulation von Kapital basieren, aber auch auf der Aneignung der reproduktiven Arbeit von Frauen im Haushalt sowie auf der Konzentration von Kapital in großen Monopolen, der Expansion von Finanzkapital und dem Wettbewerb imperialistischer Staaten, der zu globalen Kriegen und Ausplünderungen führt. Dazu gehört auch die Analyse, dass das Kapital „Differenzen“ nutzt und damit festschreibt; rassistische, frauen- und fremdenfeindliche Ideologien nährt, um so Ausbeutung zu maximieren und Spaltungen innerhalb der Reihen der Arbeiter*innenklasse zu provozieren. Diese Klassenanalyse, die weit davon entfernt ist, „ökonomisch reduktionistisch“ zu sein, beinhaltet die Interaktion von politischen und sozialen Elementen und ermöglicht ein tieferes Verständnis des Zusammenhanges von Klasse und Rassismus, Patriarchat oder Heterosexismus.
Gleichzeitig geht damit die Erkenntnis einher, dass die Arbeiter*innenklasse – die im 21. Jahrhundert diverser, rassifizierter und feminisierter ist als je zuvor –, wenn sie interne Spaltungen und Fragmentierungen überwinden kann, als einzige die Fähigkeit hat, die Grundlage für die Organisation einer neuen Gesellschaft freier Produzent*innen zu schaffen: das Kapital zu zerstören und die gesamte Wirtschaft, die Industrie, den Verkehr und die Medien unter ihre Kontrolle zu bringen. Der Rückzug aus der „Klassenpolitik“ ist in Wahrheit die Abkehr vom Kampf gegen das kapitalistische System, ohne den die schrecklichen Ungerechtigkeiten nicht beendet werden können, die durch Ausbeutung und Unterdrückung aufgrund von „race“, Geschlecht oder Sexualität hervorgebracht werden.
Seit mit der kapitalistischen Krise im Jahre 2008 neue Widerstandsbewegungen gegen neoliberale Politiken aufkamen, vertreten einige feministische Aktivist*innen sowie Teile antirassistischer Bewegungen und der Jugend auf eine andere Art und Weise die Idee der „Intersektionalität“: mit dem Ziel, dass sich verschiedene unterdrückte Gruppen zusammenschließen. So bezeichnete sich beispielsweise die Frauenbewegung, die den 8M-Streik im Spanischen Staat organisiert, als „antikapitalistisch, antirassistisch, antikolonial und antifaschistisch“. Dies stellt zweifelsohne einen sehr wichtigen Schritt nach vorn auf dem Weg zu einer Zusammenführung der Kämpfe und einen Gegenentwurf zur Fragmentierungslogik dar. Die Summe oder „Intersektion“ von Widerstandsbewegungen reicht jedoch nicht aus, wenn sie nicht mit einer gemeinsamen Strategie zur Bekämpfung des Kapitalismus versehen sind, ohne die es nicht möglich sein wird, dem Patriarchat und dem Rassismus ein Ende zu setzen.
Es geht nicht darum, „Bewegungen“ oder „Identitäten“ einer abstrakten und geschlechtslosen Arbeiter*innenklasse entgegenzusetzen. Denn noch nie zuvor war die Arbeiter*innenklasse so stark feminisiert und rassifiziert wie heute: Frauen machen 50% der Arbeiter*innenklasse aus, die somit das Gesicht von Schwarzen, lateinamerikanischen und asiatischen Frauen hat. Der Schlüssel zu einer hegemonialen Strategie besteht also darin, wieder eine Klassenpolitik in den Mittelpunkt zu rücken, die den Kampf gegen alle Formen der Unterdrückung entschlossen aufgreift. Das bedeutet, jene zu vereinen, die der Kapitalismus spaltet, und so sowohl die innere Einheit der Arbeiter*innenklasse zu stärken als auch mit Bewegungen, die gegen bestimmte Unterdrückungsformen kämpfen, Bündnisse zu schließen. Diese Perspektive ist zusammen mit dem Kampf um die Enteignung der Enteigner*innen die einzige, die es uns ermöglichen kann, in Richtung einer wirklich freien Gesellschaft voranzuschreiten.
Fußnoten
(1) Eagleton, Terry (1986): Against the Grain, Essays 1975-1985, London, Verso.
(2) Aufgrund der Geschichte des Kolonialrassismus und des Nationalsozialismus wird der Begriff „Rasse“ hier nicht verwendet, zumal auch in der deutschsprachigen Debatte der Begriff „race“ in seiner englischen Form benutzt wird.
(3) Crenshaw, Kimberlé (1989): Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, zitiert nach: Natasha A. Kelly (2019): Schwarzer Feminismus. Grundlagentexte, Münster, Unrast.
(4) Davis, Angela (1981): Women, Race and Class.
(5) Sowohl in Bezug auf Shulamith Firestones radikalen Feminismus (Frauenbefreiung und sexuelle Revolution (1987 (1970))) als auch auf Cristine Delphys materialistischen Feminismus (Der Hauptfeind (1977)).
(6) Wie von Kate Millet formuliert in: Sexus und Herrschaft (1971).
(7) Combahee River Collective (1979): A Black Feminist Statement, zitiert nach: Natasha A. Kelly (2019): Schwarzer Feminismus. Grundlagentexte, Münster, Unrast.
(8) Hill Collins, Patricia (2000): Black feminism thought, New York, Routledge. Eigene Übersetzung.
(9) Albamonte, Emilio / Maiello, Matías (2011): An den Grenzen der bürgerlichen Restauration. In: Estrategia Internacional 27.
(10) Hill Collins, a.a.O.
(11) Eagleton, Terry (1997): Die Illusionen der Postmoderne, Stuttgart/Weimar, Metzler.
(12) Giménez, Marta E. (2019): Marx, Women, and Capitalist Social Reproduction. In: Historical Materialism Book Series, Band 169, Leiden-London, Brill. Eigene Übersetzung.
Dieser Artikel erschien zuerst in Contrapunto, der Sonntagsausgabe von IzquierdaDiario.es am 24. Februar 2019.







