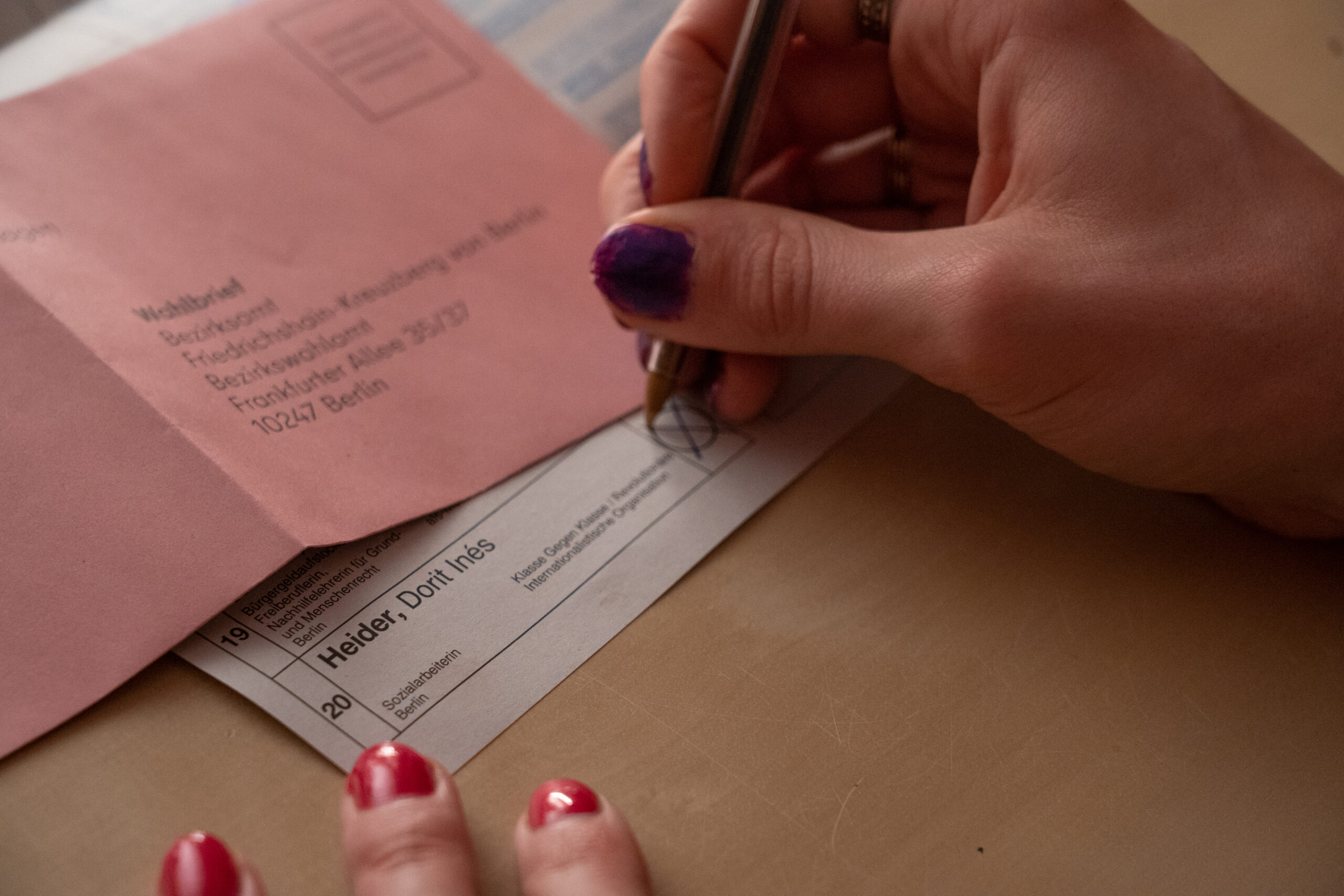Deutschland im Auge des Sturms

Wenn man der bürgerlichen Presse Glauben schenken würde, befände sich Deutschland in einem Wintermärchen. „Deutsche Firmen trotzen Europas Abschwung“ titelte Der Spiegel. Die Folge war kurz vor Jahresende ein Kursfeuerwerk der deutschen Aktien, um sich auf die Feierlichkeiten zum Jahresende einzustimmen. Beinahe als endgültiger Beweis wird auf die nach wie vor ununterbrochene Kauflust der deutschen VerbraucherInnen hingewiesen.
Und es handelt sich tatsächlich nur um ein Märchen, also eine unwirkliche Welt voller phantastischer Elemente, mit einem Helden im Mittelpunkt der Geschichte, der selbstverständlich Deutsch spricht, und sich eine Schlacht gegen böse, dunkelhäutige Kräfte (GriechInnen, ItalienerInnen, SpanierInnen) liefert, die er bisher mit seinen Waffen wie drakonischen Sparmaßnahmen und technischen Regierungen im Zaum halten kann.
Jedoch ist die Ruhe trügerisch, denn Deutschland befindet sich nicht in einer besinnlichen Winterlandschaft, sondern im Auge eines gewaltigen Sturms, der in Europa wütet. Der Hinweis auf die guten deutschen Unternehmen und schlecht arbeitenden SüdländerInnen ist somit als Versuch zu werten, von den strukturellen Ursachen der Krise abzulenken. Dennoch kann die Ruhe im Auge eines Sturms immer nur vorübergehend sein: Die ersten Winde sind mittlerweile schon zu spüren. Die Prognosen für 2012 gehen von einer „Schwächephase“ aus, denn infolge der europäischen Schuldenkrise werden eine Abkühlung des Binnenmarktes sowie ein starker Rückgang des Außenhandels erwartet, vor allem aufgrund der sich zusammenziehenden Märkte der angeschlagenen Länder der Eurozone. Der wütende Sturm nähert sich langsam, aber unaufhaltsam den deutschen Grenzen.
Die Rezession erreicht langsam Deutschland
Noch sind die Auftragsbücher deutscher Konzerne und Unternehmen relativ gut gefüllt. Dennoch: Bereits jetzt lahmt das Wachstum in den Euro-Krisenstaaten. Selbst Deutschlands wichtigster Handelspartner Frankreich gleitet in die Rezession und wurde kürzlich von der Rating-Agentur Standard and Poor‘s mit dem Entzug der Bestnote abgestraft. Ein vom Export stark abhängiges Land wie Deutschland kann aber nicht auf den europäischen Markt verzichten: Die Nachfrage nach deutschen Autos, Maschinen oder Chemieprodukten sinkt bereits. Die Kürzungspakete und Steuererhöhungen in Italien und Spanien sowie die laufenden Entlassungen in ganz Europa werden die Kaufkraft für deutsche Produkte verringern. Bereits jetzt sinkt die Nachfrage für Autos in Spanien und Frankreich. In Griechenland werden Autos sogar von der Versicherung massiv abgemeldet. Dass Schwellenländer wie China oder Brasilien weiter wachsen (wohl aber langsamer als sonst) hilft auch nicht viel, denn im Vergleich zu den Euro-Märkten spielen sie für die deutschen Exporte bisher nur eine untergeordnete Rolle[1].
Die Erholung der deutschen Wirtschaft ist eng mit der Erholung des Welthandels verbunden. Diese Tatsache ermöglichte es Deutschland, mit seiner Handelsüberschusspolitik fortzufahren – was die bereits vorhandenen Ungleichgewichte weiter verschlimmert hat. Andererseits erklärt sich der deutsche „Aufschwung“ damit, dass viele InvestorInnen ihre Gelder aus den angeschlagenen Ländern Europas, und sogar aus Frankreich und den Niederlanden, abgezogen haben. Dieses Geld wurde in deutsche Staatsanleihen investiert und hat somit die Marktzinsen in Deutschland nach unten gedrückt. Schließlich zahlen sich die auferlegten Kürzungsprogramme der Troika Deutschland (und Frankreich)-IWF-EZB jetzt aus, denn Länder wie Griechenland und Portugal müssen nun für die „solidarischen“ Kredite und versprochenen Garantien massiv Gebühren zahlen.
Jedoch kann der konjunkturelle Höhenflug nicht über die strukturellen Probleme der deutschen Wirtschaft hinwegtäuschen: Deutschland braucht ein neues Akkumulationsmodell, um das bereits gewonnene Terrain auf dem Weltmarkt zu behaupten. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gründet nämlich auf einer lange anhaltenden Angriffsserie auf die arbeitende Bevölkerung, was dazu geführt hat, dass Deutschland selbst in der bürgerlichen Presse als „Billiglohnland“[2] gehandhabt wird. Doch diese Angriffe waren nur der Anfang. Die herrschende Klasse muss die im Vergleich zu anderen imperialistischen Ländern wie den USA nach wie vor zu hohen Produktionskosten senken. Dies geht nur durch einen massiven Angriff auf die ArbeiterInnenklasse, um die sinkende Produktivität umzukehren.
Nun neigt sich der Aufschwung der deutschen Wirtschaft unaufhaltsam seinem Ende zu. Die europäische Industrie befindet sich seit fünf Monaten in der Rezession. In allen europäischen Ländern streichen Betriebe weiter Stellen, bauen ihre Lager ab und kürzen die Einkaufsmenge. Die sinkende Nachfrage nach Industriegütern „Made in Germany“ ist der Auftakt zu kommenden Entlassungen in Deutschland. Deshalb fordern bereits jetzt unisono Gewerkschaftsspitzen und Industriebosse die Verlängerung der Kurzarbeitsregelung, also die Teilarbeitslosigkeit zu Gunsten der KapitalistInnen, und in letzter Instanz zu Lasten der Lohnabhängigen. Der Zugriff auf diese Maßnahme wird jedoch die Verschuldung Deutschlands weiter antreiben, was sich in einer schlechteren Bonität und somit in der Bestrafung durch die Märkte ausdrücken wird, was wiederum Sprit für den sozialen Rasenmäher bedeutet.
„Faule Südländer, fleißige Deutsche“
Der deutsche Imperialismus hat Fortschritte gemacht in der Halbkolonialisierung seines europäischen Hinterhofes: Er hat auf Kosten seiner imperialistischen Konkurrenten Stellungen in der europäischen Peripherie aufgebaut. Die politischen Kosten dieses unilateralen Gangs sind jedoch enorm, denn sie vergrößern die Spannungen zwischen den verschiedenen imperialistischen Staaten der EU, wie das britische „Nein“ beim Gipfel zur EU-Reform im Dezember oder die Kritik der IWF-Präsidentin Lagarde an Merkel zeigt. Dabei ist dies nur der Anfang einer Periode wachsender zwischenstaatlicher Spannungen, die für die Ausgebeuteten und Unterdrückten nichts Gutes verheißen. So sind heute die von den Euro-Gipfeln getroffenen Maßnahmen unzureichend, um die Krise in der Eurozone zu lösen – sie drohen umgekehrt sogar zum Bankrott der Eurozone zu führen. Die vorübergehende Alternative zum Bankrott wäre die vertiefte Unterwerfung der schwächeren europäischen Wirtschaften unter die deutschen Diktate. Es ist die Wahl zwischen Bankrott und Unterwerfung, im Endeffekt zwischen Pest und Cholera.
Angesichts der sich trübenden gesellschaftlichen Perspektiven verstärken sich die rechtspopulistischen Töne, mal in offener, mal in subtiler Weise. Bürgerliche PolitikerInnen, KarrieristInnen, MeinungsmacherInnen, Xenophobe greifen auf nationalistische Stereotype zurück und treiben damit einen Keil zwischen die einheimischen und ausländischen Lohnabhängigen, zwischen „fleißige Deutsche“ und „faule Südländer“. Somit wollen sie die politische Auseinandersetzung über die Krise des Kapitalismus in einer Fäkaliengrube ertränken: Da aalen sich die SüdländerInnen unter der Sonne, hier arbeiten die fleißigen und sparsamen Deutschen (die MigrantInnen gehören ja nicht dazu) bei Sturm und Hagel. Und nun müssen die „Deutschen“ für die Fehler der anderen wieder einmal zahlen… Deshalb hat Merkel in ihrer Neujahrsansprache die BürgerInnen auf harte Zeiten eingeschworen, denn die Tiefe der jetzigen Wirtschaftskrise ist historisch. Sie wird als „die größte zivile Bedrohung (…), der sich Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg gegenübersieht“[3], dargestellt.
Unter diesem sehr ungünstigen Stern wäre für die herrschenden Klasse eine starke Regierung von Nöten: Eine Regierung, die sich nicht zerfleischt und in der Lage ist, ihr arbeiterInnenfeindliches Programm durchzuführen. Aber dies ist nicht der Fall, denn die Regierungskoalition ist aufgrund der terminalen Krise der FDP mehr oder weniger handlungsunfähig. Ihre politischen VertreterInnen werden eineR nach dem/der Anderen der Lüge und Vetternwirtschaft bezichtigt. Die Parteien als Säulen des Regimes sind in eine Krise geraten. Konnten sie früher die Interessen verschiedener Sektoren gleichzeitig artikulieren, gilt dies heute nicht mehr. So kommt es allmählich zu einem Prozess der Neudefinition der politischen Allianzen und Projekte. Die FDP könnte ganz verschwinden. Der Erosionsprozess in der SPD schreitet untergründig, aber im historischen Maße unaufhaltsam voran. Trotz den Beteuerungen von Sigmar Gabriel, dass die Krise der SPD überwunden sei, ist sie in Wahrheit nur deswegen nicht mehr tagesaktuell, weil sie nicht an der Regierung ist. Die Linkspartei versucht einen neuen Anlauf, die SPD zu „resozialdemokratisieren“. Dabei verliert sie in den Umfragen weiter an Zustimmung, und auf der Straße sieht man sie höchstens an sonnigen Tagen oder bei ritualisierten Kundgebungen. Die Grünen haben dabei etwas Grund zur Freude, denn ob sie zu einer längerfristigen Alternative für die herrschenden Klasse werden können, wird von ihr noch getestet. Jedoch ist ihre systemkonforme Lösung, ihr „Green New Deal“, eine Fiktion für Boom- und nicht für Krisenzeiten. Die Partei CDU-CSU kann nicht mehr Heimat für so viele verschiedene Vorstellungen sein, die weder fundamentale ChristInnen noch aufgeklärte MarktanhängerInnen, weder EuroskeptikerInnen noch Eurobegeisterte gleichermaßen bedienen[4].
Diese Situation begünstigt die Entstehung einer rechtspopulistischen Instanz, einer Partei der deutschen Werte, in der Leute wie Thilo Sarrazin, Gabriele Pauli, Karl-Theodor zu Guttenberg und Erika Steinbach Platz hätten. Denn auch in Deutschland nimmt der Rechtspopulismus immer klarere Konturen an, weil viele Menschen in der Sorge um den eigenen Wohlstand angesichts der Schuldenkrise dem rechten Sirenengesang, die anderen seien Schuld an der Misere, verfallen. Aus der Sorge um die Stabilität des Euros wird die Furcht vor dem Euro. Laut einer aktuellen Umfrage von Infratest Dimap sehen 57% der BundesbürgerInnen die Einführung des Euros als eine falsche Entscheidung. Mehr als jedeR Dritte hätte am liebsten sofort die D-Mark zurück. Diese Sehnsucht nach Heil, die Rückkehr in die BRD des Booms, soll eine Partei bewerkstelligen, die die Überdehnung Europas und den geplanten Türkei-Beitritt zur EU verhindert, die die deutschen Interessen (sprich, die der herrschenden Klasse) vor die europäischen stellt, die der „Überfremdung“, vor allem der muslimischen, Einhalt bietet, die die „Abschaffung Deutschlands“ verhindert. Kurz, eine Partei der enttäuschten Wirtschaftsliberalen, Euro-SkeptikerInnen und RassistInnen[5]. Sie bereiten sich also auf die kommenden scharfen sozialen Auseinandersetzungen vor.
Quo vadis, Demokratie?
Per Verordnung oder Gesetz werden immer größere Verschärfungen des AusländerInnenrechts und weitreichende Einschränkungen vieler demokratischer Rechte beschlossen: Erfassung biometrischer Daten, Kontrolle von Reisebewegungen und Finanztransfers, Telefonüberwachung, geheimdienstliche Beobachtung von linken Kräften. Die Liste der seit 2001 im Zuge des „Krieges gegen den Terror“ getroffenen Maßnahmen zur Wahrung der „inneren Sicherheit“ ist lang. Sie geben einen Eindruck vom Umfang der unaufhaltsamen Aushöhlung der bürgerlichen Demokratie, die sich seit der Wirtschaftskrise noch weiter verschärft hat. Noch haben jedoch wenige Sektoren die repressive Seite erlebt. Unter Hinweis auf die Terrorismusbekämpfung sind die ersten Opfer AntifaschistInnen (siehe Naziblockaden in Dresden, siehe die geheimdienstliche Überwachung der Linkspartei), MigrantInnen und Muslime.
Die Überwachung am Arbeitsplatz nimmt ebenfalls zu: MitarbeiterInnen werden gefilmt, Versammlungen abgehört, E-Mails durchleuchtet. Das Ziel ist eindeutig: Proteste schon vor ihrem Entstehen zu unterbinden, die Selbstorganisation der Beschäftigten im Keim zu ersticken, unbequeme Angestellte zu entlassen.
Auch auf parlamentarischer Ebene lässt ich eine ähnliche Entwicklung ausmachen. Wie die Perspektiven für das Saarland heute (und für den Bund morgen) zeigen, wird das Mehrheitsprinzip, sprich die Demokratie, zunehmend durch den großkoalitionären „Konsens“ ersetzt, „der auch die nächste Wahl und die nächsten Jahre überdauert.“[1]. Denn einen Sparkurs zu fahren, der der „Schuldenbremse“ gerecht wird, erfordert „Legitimität“.
Die sich verschlimmernde wirtschaftliche Lage der ArbeiterInnenschaft und der Unterdrückten, die zunehmende soziale Polarisierung, die Abwendung breiter Bevölkerungsschichten von den traditionellen politischen Parteien wie CDU und SPD, die Zunahme der polizeilichen Repression: All dies deutet darauf hin, dass die „schönen“ Zeiten der bürgerlichen Demokratie sich auch in Deutschland ihrem Ende zuneigen. Die Perspektive sind pseudodemokratische Systeme, in denen selbst formelle demokratische Rechte beschnitten werden.
In diesem Sinne ist es für uns als revolutionäre MarxistInnen eine Notwendigkeit, für die Verteidigung der demokratischen Errungenschaften wie auch für deren Ausweitung einzutreten. Streik-, Versammlungs- und Demonstrationsrecht wurden hart erkämpft – heute werden sie wieder beschnitten. Wie die Erfahrung zeigt, können wir nicht darauf vertrauen, dass diese und viele andere Rechte für immer und ewig erkämpft wurden. Sie sind für uns kein Selbstzweck, sondern sie geben uns lediglich bessere Ausgangsbedingungen für die Bekämpfung des bürgerlichen Staates, der dazu tendiert, die demokratischen Rechte mittels Verordnungen und Dekreten auszuhöhlen. Die bürgerliche Demokratie ist nach wie vor „die aristokratischste aller Herrschaftsformen“[2], denn sie verdeckt ihren Klassencharakter mit dem Hinweis auf formelle politische Gleichheit, während in Wirklichkeit ganze Bevölkerungsschichten wie etwa Asylsuchende nicht mal elementarste formelle Rechte genießen.
Daher treten wir für eine andere Art der Demokratie ein. Wir wollen keine vom berüchtigten Verfassungsschutz geschützte und im Dienste der Konzerne und Banken agierende Demokratie für Reiche. Wir wollen also keine bürgerliche Demokratie, sondern eine proletarische Demokratie: eine Demokratie der selbstbestimmten Organe der Massen, eine Rätedemokratie, die sich durch Prinzipien wie Rotation, jederzeitige Abwählbarkeit von Delegierten und die direkte Entscheidung der Massen über ihre eigenen Angelegenheiten auszeichnet. Unser Ziel ist die Diktatur des Proletariats, die Herrschaft der großen Mehrheit der Bevölkerung gegen die kleine Minderheit aus GroßkapitalistInnen und Bankiers zur Überwindung der kapitalistischen Ausbeutung.
Fußnoten
[1]. Saarbrücker Zeitung: Saar-Wirtschaft setzt auf neue Regierung.
[2]. Leo Trotzki: Das Übergangsprogramm. Arbeiterpresse-Verlag 1997. S. 5.
Perspektiven für 2012
Die Krise wird die Lebensbedingungen der großen Mehrheiten in diesem Jahr weiterhin verschlechtern. Bisher mussten insbesondere die stark prekarisierten Sektoren der ArbeiterInnenklasse wie die Arbeitslosen, Jugendlichen und Frauen Einbußen auf sich nehmen. Deren soziale Absicherung wurde der Standortlogik und der Sozialpartnerschaft geopfert. Der Degen, mit dem das Ausbluten eingeleitet wurde, wurde von der Gewerkschaftsbürokratie in die Hände der KapitalistInnen gelegt. Die Folgen sind dramatisch gewesen. Explosionsartiger Anstieg der prekären Beschäftigung, Zunahme von Hungerlöhnen, Kinderarmut, etc. Die Inflationsrate erhöhte sich bereits im achten Quartal in Folge und frisst die oft mickrigen Lohnerhöhungen der letzten tariflichen Auseinandersetzungen komplett auf. Während die Preise um 2,5 Prozent stiegen, lag die durchschnittliche Lohnentwicklung deutlich unterhalb der Inflation.
Allerdings haben nicht alle Beschäftigte stark bluten müssen. Für die Vollzeitbeschäftigten in der verarbeitenden Industrie, im Bergbau, aber auch in manchen Dienstleistungsberufen lag der Gehaltsanstieg über der Inflation, was auf ein Wiedererlangen des Selbstbewusstseins der Beschäftigten hinweist. Jedoch hat genau dieser Sektor in den vergangenen 20 Jahren erheblich an Bedeutung verloren: Waren 1991 noch 28,5 Prozent aller Erwerbstätigen in der Industrie beschäftigt, sind es heute nur noch 18,7 Prozent. Der Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor, in dem schlechter bezahlte und unsicherere Jobs häufiger zu finden sind, stieg von 60,9 Prozent im Jahr 1991 auf 73,8 Prozent im Jahr 2011 (an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen berechnet[6]). Dieser Prozess wäre nicht ohne die unsägliche Politik der Demobilisierung und den Verrat der Gewerkschaftsspitzen möglich gewesen. Jedoch sieht die unmittelbare Zukunft auch in der verarbeitenden Industrie schwarz aus, denn einerseits brechen die Bestellungen ein und die Unternehmen schrauben die Produktion zurück, andererseits ist das Produktivitätswachstum niedriger als in anderen imperialistischen Ländern, so dass die herrschende Klasse eher früher als später diesen aus ihrer Sicht unmöglichen Zustand mittels Massenentlassungen korrigieren muss. Es ist durchaus im Rahmen der Möglichkeiten, dass dieses Jahr die große Angriffswelle beginnt. Auch die ArbeiterInnen aus dem Industriebereich sollten sich auf diese Perspektive vorbereiten. Die Angriffe in Griechenland, Italien und nun Spanien sind ein Alarmsignal für die hiesigen Beschäftigten.
Diese Situation hat zu einer paradoxen Entwicklung geführt, bei der die tragenden Elemente von Widerstand oft bei den Beschäftigten im Dienstleistungsbereich anzutreffen sind, also in jenem Bereich, der nicht unmittelbar den Bedingungen des Weltmarktes unterworfen ist. Dies ist so, weil sie einerseits heute etwas vom Aufschwung haben wollen, andererseits, weil sie oft auf konfliktbereite UnternehmerInnenverbände treffen: FluglotsInnen, LokführerInnen, Telekom, S-Bahn in München, etc. Sie sehen, wie ihre Gewerkschaften ihre Interessen doch nicht vertreten, und so kehren sie diesen bürokratischen Monstern zunehmend den Rücken. Dadurch hat sich die Tendenz zur Entwicklung von Spartengewerkschaften verstärkt, die eine relative Schwächung der ArbeiterInnenbewegung darstellt, aber gleichzeitig eine Form ist, wie manche Sektoren der Arbeiter-Innenschaft sich nach wiederholtem Verrat von ihren Führungen distanzieren konnten. Ironischerweise greifen die Gewerkschaftsspitzen und KapitalistInnen die Spartengewerkschaften gemeinsam an, wohl aber aus unterschiedlichen Gründen: die KapitalistInnen, weil sie keine so zuverlässigen GesprächspartnerInnen mehr haben; die Gewerkschaftsspitzen, weil sie dadurch unter Druck gesetzt werden und sich so widerwillig etwas kämpferischer geben müssen.
Dabei entdecken manche Beschäftigte in jüngerer Zeit längst verloren geglaubte militante Methoden langsam wieder, wie Streiks ohne Vorankündigung und Blockaden von Betriebstoren. Auffallend viele junge Frauen und MigrantInnen sind bereit, in den Kampf zu ziehen. ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, Beschäftigte im Einzelhandel wie bei H&M oder der Drogeriekette Schlecker, Reinigungskräfte wie beim CFM-Streik etc. Denn die jungen Generationen von ArbeiterInnen sind weniger belastet von der zersetzenden Last der Sozialpartnerschaftslogik. Sie kennen nichts anders als angriffslustige Chefs. So ist ihnen das sozialpartnerschaftliche Geschwätz der Gewerkschaftsbürokratie befremdlich. Sie schauen in ihren Bekanntenkreis und sehen, wie ihre FreundInnen und Verwandten entweder wieder mal ein Praktikum absolvieren oder kaum über die Runden kommen.
Auf der anderen Seite wächst die Angst der Mittelschicht vor dem Absturz in prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitslosigkeit. Mit Entsetzen wird festgestellt, dass die Eltern den ererbten Wohlstand nicht auf ihre Kinder übertragen werden können. Ihre Zukunft sind endlose PraktikantInnenstellen, Drosselung des Konsums und die Unmöglichkeit, Karriere zu machen – eine wohlbekannte Situation für ArbeiterInnenkinder. Die Krise aktualisiert somit eine der Grundthesen des Marxismus: Die Pauperisierung der Mittelschichten schreitet voran. Somit entstehen Möglichkeiten für die Solidarisierung zwischen verschiedenen Sektoren der Unterdrückten. Hier die ArbeiterInnenjugend, da die Jugend an den Universitäten, vereint in der Unsicherheit und zunehmenden Misere – vorausgesetzt, die ArbeiterInnenbewegung und ihre Avantgarde entwickelt eine Politik, die die kleinbürgerlichen Schichten der Bevölkerung anspricht, damit sie nicht im Netz der Rechten gefangen werden.
Aufgaben für RevolutionärInnen
Trotz aller Widersprüche der aktuellen Entwicklung – vom momentanen, begrenzten Aufschwung bis hin zur Stärkung des Rechtspopulismus – bietet diese Situation Interventionsmöglichkeiten für RevolutionärInnen an, mittels einer klaren und kühnen Politik die Grundlagen für eine neue revolutionäre Partei der ArbeiterInnenklasse und Jugend zu legen. Denn heute geht es darum, sich auf die unweigerlich kommenden scharfen Auseinandersetzungen zwischen den Klassen vorzubereiten. Es geht darum, eine strategische Allianz zwischen dem Proletariat und anderen unterdrückten Sektoren – und dabei ist die Rolle der Jugend zentral – herzustellen. Es geht darum, die politisch-programmatischen Errungenschaften der weltweiten ArbeiterInnenbewegung zu entstauben. Wir, junge ArbeiterInnen und Studierende, müssen die Lehren aus den zahlreichen Niederlagen und wenigen Siegen ziehen, um uns auf die kommenden Ereignisse des Klassenkampfes vorzubereiten. So ist es heute eine unaufschiebbare Aufgabe, die Beziehung zwischen dem Proletariat und dem revolutionären Marxismus, die durch die Hegemonie sozialdemokratischer oder stalinistischer Parteien in der ArbeiterInnenbewegung behindert wurde, wiederherzustellen. Wir müssen heute für die Unabhängigkeit der ArbeiterInnenklasse gegenüber der Bourgeoisie und ihren AgentInnen kämpfen. Dafür muss eine neue Partei der Ausgebeuteten und Unterdrückten aufgebaut werden. Eine Partei, die die parlamentarische Tribüne nur dazu nutzt, um mit den Massen zu reden, nicht um die bürgerliche Demokratie vor deren Verfall zu retten, wie es die Linkspartei tut.
Dafür bedarf es eines Übergangsprogramms zur Revolution, denn ohne eine Politik der Intervention im aktuellen Klassenkampf, die die Konflikte als eine „Kriegsschule“ des Klassenkampfes versteht und für die Entmachtung der bürokratisierten Gewerkschaftsführungen kämpft, die für ArbeiterInnendemokratie und für klassenkämpferische Tendenzen innerhalb der Gewerkschaften eintritt, werden die Ausgebeuteten und Unterdrückten wieder einmal die Kosten der Krise tragen müssen, mit allen möglichen Folgen.
In Europa – und Deutschland wird nicht von dieser Entwicklung verschont bleiben – bricht eine neue Etappe an: eine Etappe, die von mehr Klassenauseinandersetzungen und letztendlich von Revolution und Konterrevolution gekennzeichnet sein wird. Und gleichzeitig verfallen breite Sektoren der radikalen Linken in Skepsis. Sie sehen die Aufgabe der Stunde in der Druckausübung auf reformistische Apparate, nicht im Aufbau einer revolutionären Fraktion in der ArbeiterInnenbewegung. Sie sprechen von demokratischem Sozialismus, von der Stärke der Ideen und vergessen dabei, die Avantgarde auf den unbarmherzigen Kampf in den Betrieben, gegen die BesitzerInnen und die Gewerkschaftsbürokratie, vorzubereiten.
Für uns dagegen besteht die dringende Aufgabe der Stunde darin, den revolutionären Marxismus im Schoße der ArbeiterInnenklasse wieder zum Leben zu erwecken. Die Periode der politischen und wirtschaftlichen Instabilität hat gerade erst begonnen. Die Zeiten von weitreichenden Zugeständnissen, von Sozialpartnerschaftslogik und Interessenversöhnung, sind angesichts der sich verschlimmernden Krise Vergangenheit. Was es noch geben kann, sind mickrige Zugeständnisse, die den Ausgebeuteten und Unterdrückten immer mehr wie eine Ohrfeige erscheinen werden. Soziale Spannungen und Klassenkämpfe in gesteigerter Form sind nur noch eine Frage der Zeit. Die Geschichte der ArbeiterInnenbewegung in Deutschland mahnt uns: Legen wir heute die Grundpfeiler einer neuen revolutionären Partei für den Sieg, die Partei der Vierten Internationale!
Fußnoten
[1]. Sebastian Dullien: „Wirtschaftsszenarien 2012: Hallo Krise!“ Spiegel Online 31.12.2011.
[2]. Spiegel Online: „Deutschland verkommt zum Billiglohnland“, 29.12.2011.
[3]. Jakob Augstein: „Wulff, Lindner, Chaos“, Spiegel Online 15.12.2011.
[4]. „Parteigründung liegt in der Luft“, N-TV 13.09.2010. .
[5]. Siehe auch: Juan Chingo: „Ein neuer bonapartistischer Kurs in Europa“.
[6]. Insgesamt stieg die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland in diesen zwei Jahrzehnten von 38,77 Millionen auf 41,04 Millionen. Soviel zur oft genannten These, dass es in Deutschland keine ArbeiterInnen geben würde!
Drei Wege aus der Krise
Ein arbeiterInnenfeindlicher Weg:
Für die herrschende Klasse geht der Weg aus der Krise über die Aufbürdung der Kosten auf die subalternen Klassen[1]. Dies geht heute über die Rettung des Euros, koste was es wolle, denn die herrschende Klasse in Deutschland zieht den größten Nutzen aus der Währungsunion. Wie einer Rede von „Arbeitgeber“präsident Dieter Hundt[2] zu entnehmen ist, bedeutet dies in der Praxis mehr Spardiktate für die Mittelmeerländer.
Aus Sicht der herrschenden Klasse sind die Herausforderungen für die nächsten Jahre die Sanierung der öffentlichen Haushalte, d.h. weniger Geld für Soziales, Gesundheit und Bildung ausgeben, die Wettbewerbsfähigkeit sichern usw.: allesamt Maßnahmen, die nur mittels niedrigerer Tarifabschlüsse, Lohnzurückhaltung, und – falls die Böen der Krise Deutschland wieder treffen – den erneuten Einsatz von Kurzarbeitergeld durchzusetzen sind. Jene Medizin, die für die PIIGS[3] gut ist, muss auch gut für Deutschland sein: So werden angesichts der dramatischen Haushaltsnotlage die Bundesländer Berlin, Bremen, das Saarland sowie Schleswig-Holstein schärfer am Kragen gepackt. Diese vier finanzschwachen und hoch verschuldeten Länder müssen nun zum ersten Mal in der bundesrepublikanischen Geschichte ein Fünf-Jahres-Programm zur Sanierung ihrer Haushalte vorlegen und sich Kontrollen unterwerfen, denn sie müssen diszipliniert werden: „Wenn Griechenland, Spanien und Italien Schulden abbauen müssen und andernfalls bestraft werden, dann muss das Gleiche auch für die Länder Berlin, Bremen, Brandenburg oder Rheinland-Pfalz gelten“, sagte Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU)[4]. Oder anders gesagt: weniger Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Infrastrukturabbau, Deregulierung des Arbeitsmarktes und eine Goldgrube für private AnbieterInnen von Leistungen, die heute in staatlicher Hand liegen.
Ein reformistischer Ansatz:
Die GewerkschaftsführerInnen verfolgen nach wie vor eine sozialpartnerschaftliche Politik, als ob das Kapital sich noch in einer Aufschwungphase befände und es die Möglichkeit gäbe, bei den KapitalistInnen nennenswerte Zugeständnisse herauszuholen. Die Gewerkschaftsbosse zeigen sich mit den besitzenden Klassen solidarisch und sind bereit, alle arbeiterInnenfeindlichen Maßnahmen, die die Herrschenden zur Rettung des Kapitalismus verordnen, mitzutragen. „Hieraus leiten sich eine Reihe von wirtschaftpolitisch dringend umzusetzenden Alternativen im Sinne eines Links-Keynesianismus ab.“[5] Zusammengefasst: für die Gewerkschaftsbosse ist „ein Kurswechsel hin zu einer sozialen marktwirtschaftlichen Demokratie“[6] notwendig. Um all dies zu erreichen, schlägt die Gewerkschaftsbürokratie, statt zum Kampf aufzurufen, Bündnisse zwischen Gewerkschaften und KonsumentInnen vor, um mittels Konsumboykotts die Unternehmen unter Druck zu setzen – von Streiks keine Rede.
Im Einklang mit diesen keynesianistischen Vorstellungen beschränken sich die Forderungen der Linkspartei – und um sie kreisen leider auch Gruppen und Parteien, die sich als trotzkistisch bezeichnen – auf die Bekämpfung der schlimmsten Auswüchse, anstatt die Wurzel des Problems anzupacken: den Kapitalismus. Das zentrale Problem für die Linkspartei ist, im Einklang mit den Vorstellungen der GewerkschaftsbürokratInnen, nicht der Kapitalismus per se, sondern seine aktuelle Ausformung. Hinter den Forderungen nach mehr Regulierung der Märkte und Demokratisierung der Wirtschaft steckt die reaktionäre Vorstellung, es existiere eine ökonomische Sphäre (der Finanzsektor), der nicht mehr unter staatlicher Kontrolle läge, daher die derzeitige wirtschaftliche Krise, und die Aufgabe sei die Stärkung des (bürgerlichen) Staates als Kontroll- und Regulierungsinstanz des Finanz- und produktiven Kapitals. Dabei wird trotz allen Bekundungen der Klassenkampf der Wahlagenda untergeordnet.
Eine revolutionäre Perspektive:
Für revolutionäre MarxistInnen besteht die Aufgabe heute darin, eine klare Perspektive des Kampfes gegen die Maßnahmen der herrschenden Klasse zu entwickeln, sowohl auf ideologischer Ebene als auch in der täglichen Praxis, durch die Gründung von Strukturen in Betrieben, in denen es keine gibt, durch die Durchführung von Streiks zur Verteidigung von hart erkämpften Errungenschaften etc. Jedoch kann sich der von den Lohnabhängigen durchzuführende Kampf nicht nur auf die Betriebe beschränken, bzw. auf die Durchführung von punktuellen Streikaktionen. Der Kampf muss verallgemeinert werden und dabei mit dem ideologischen Kampf gegen den Klassenfeind sowie dessen AgentInnen innerhalb der ArbeiterInnenreihen verbunden werden.
Es geht also darum, die Illusionen zu bekämpfen, die GewerkschaftsbürokratInnen und Parteien wie die Linkspartei in den bürgerlichen Staat, seine Institutionen und die Möglichkeit der Aussöhnung der Klasseninteressen säen, um Enttäuschung und Desorganisation unter den subalternen Klassen zu vermeiden. In den Betrieben geht es folglich darum, eine kämpferische und antibürokratische Strömung zu schaffen, die der Sozialpartnerschaftslogik und dem Reformfetischismus eine revolutionäre Perspektive entgegensetzt. An den Schulen und Universitäten geht es darum, den Aufbau einer antikapitalistischen, antiimperialistischen, pro-ArbeiterInnen- und revolutionären Strömung voranzutreiben – eine Strömung, die dem Kapitalismus eine sozialistische Perspektive, der nationalbornierten Standortlogik die effektive Solidarität zwischen den vaterlandslosen Ausgebeuteten, dem zersetzenden Individualismus die Solidarität unter den Unterdrückten, der Reaktion die Revolution entgegensetzt.
Fußnoten
[1]. Den Begriff „subaltern“ benutzen wir synonym für ausgebeutete, unterdrückte und/oder marginalisierte Gruppen.
[2]. Dieter Hundt: „Kurs halten für Wachstum und Beschäftigung“, 22.11.2011.
[3]. Die Abkürzung PIIGS wurde zum ersten mal während der Staatsschuldenkrise im Euroraum 2010 verwendet. Die Buchstaben stehen für die fünf Euro-Staaten Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien.
[4]. radiobremen: „Söder greift Bremer Finanzpolitik an“, 16.12.2011.
[5]. Heinz-J. Bontrup: Zur größten Finanz- und Wirtschaftskrise seit achtzig Jahren. Ein kritischer Rück- und Ausblick und Alternativen. März 2011. S. 47.
[6]. Berthold Huber: „Die IG Metall will einen Kurswechsel“.