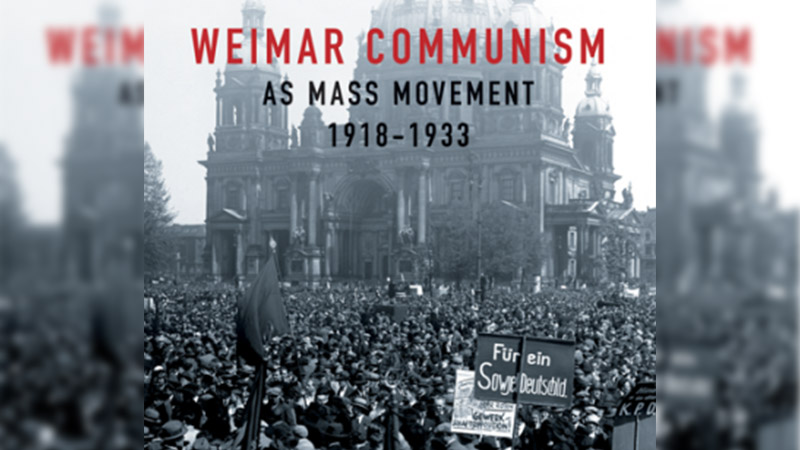Buchbesprechung: Thomas Piketty – Kapital und Ideologie
Der „Star-Ökonom“ Thomas Piketty trifft mit Vertreter*innen der Linkspartei online zusammen, um über seine Sicht auf Europa und die Wirtschaftskrise zu diskutieren. Gastautor Florian Geisler bespricht das neue Buch „Kapital und Ideologie“.

Wenn politische Kommentare sich kritisch mit der heutigen Lebensweise der westlichen Welt und ihren globalen Beziehungen auseinandersetzen, ist meistens vom Begriff „Neoliberalismus“ die Rede. Weil dieser aber ein sehr weit gefasstes und manchmal schwer greifbares Feld von Phänomenen beschreibt, macht sich Thomas Piketty, weltbekannter Ökonom und Sozialwissenschaftler und laut Beck Verlag „Karl Marx des 21. Jahrhunderts“, auf, das Problem mit einem neuen Begriff auf den Punkt zu bringen: dem von ihm so genannten „Proprietarismus“.
Das schwer übersetzbare Konzept des französischen proprietarisme bezeichnet eine Wirtschafts- und Lebensweise, die auf privates Eigentum fixiert ist. Nicht einfach allgemein die Leistungsgesellschaft, nicht allein die Kontrolle und Überwachung der Menschen, und auch nicht das Privateigentum an Produktionsmitteln generell, sondern die Ideologie des Besitzens, des Innehabens, des Rechte-an-etwas-Habens ist laut Piketty die entscheidende Konstante der westlichen Welt, die wichtigste Ideologie der Moderne.
Proprietarismus und Ideologie
Gemeint ist damit etwa der gesellschaftliche Aufschrei, wenn große Warenhäuser in Zahlungsnöte geraten und ihre Mieten nicht mehr bezahlen wollen: Bemerkenswerterweise werden gerade diejenigen, die selbst kaum direkt von Einnahmen aus Eigentum profitieren, nicht müde, lautstark nach einem Schutz der Interessen der Eigentümer*innen der Ladenflächen zu verlangen. Obgleich sich die Gesellschaft inmitten eines Notstands befindet, der den Lebens- und Arbeitsalltag von Milliarden Menschen durcheinanderwirbelt, darf scheinbar an den quasi heiligen Eigentums- und Grundrechten auf Rendite nicht gerüttelt werden, während Arbeitnehmer*innenrechte regelmäßig mit Füßen getreten werden, ohne dass danach ein Haar kräht – wer erinnert sich an den letzten Aufschrei gegen die Arbeitsbedingungen in Adidas-Nähereien?
Diese heutige, „neopropietaristische“ Weltsicht, bei der es stets nur um den Schutz von Besitz geht, ist für Piketty eben nicht einfach nur ein Irrglaube oder Irrtum, sondern tatsächlich Ideologie im starken, klassischen Sinn des Wortes, weil damit auch ein Märchen vom Fortschritt und Wachstum erzählt wird. Die Menschen versprechen sich vom Schutz des Eigentums einen höheren Wohlstand und größere Stabilität. Wir kennen diese Sichtweise heute zu genüge: Arbeitsplätze werden geschaffen, Wohnungen werden gebaut, Ressourcen werden erschlossen, Innovationen werden implementiert – angeblich stets von privaten Kapitalgesellschaften und genialen Menschen „mit Visionen“. Piketty deckt diese Lüge auf: Privateigentum und ökonomischer Prosperität gehen laut seinen Daten eben gerade nicht Hand in Hand.
Im Gegenteil: Europa genauso wie die USA verdanken ihre globale Dominanz vielmehr einer „Reihe von Enteignungen und Verstaatlichungen und generell politische[n] Entscheidungen, die explizit darauf abzielten, den Wert des Privateigentums für die Eigentümer und die Machtposition der Eigentümer in der Gesellschaft zu reduzieren“. Gemeint ist der historische Aufstieg des Sozialstaats als Herrschaftstechnik, der durch die staatlich gelenkten Zerstörungen und Wiederaufbauprogramme des ersten und zweiten Weltkriegs nötig geworden war. In einer unvergleichlichen Umstrukturierung der Welt wurden umfassende Vermögen enteignet und ein völlig neuer Sektor geschaffen: der Staatshaushalt.
Piketty führt zur Illustration dieser These beeindruckende Zahlen an. Ein besonders deutliches Beispiel: Der reale, bereinigte Wert der Mieten fiel in Frankreich bis 1950 unter ein Fünftel des Werts von 1914, und stieg erst in den 2000er Jahren wieder langsam auf sein altes Niveau. Wir müssten uns heute, inmitten einer absurden Dauerkrise der städtischen Wohnungsmärkte, also eine Welt vor Augen führen, in der in den Großstädten die realen Preise für das Wohnen bis etwa ins Jahr 2055 um satte 80% sinken (!) müssten, um eine vergleichbare Entwicklung vor uns zu haben. Für uns ist das eine unglaubliche Vorstellung, und doch nicht ohne historische Präzedenz. Pikettys Stärke ist es, linken wie rechten Ökonom*innen und Politiker*innen die schiere Größenordnung der sozialen Ungleichheit unserer Gegenwart vorzurechnen, und glaubhaft zu machen, in welcher Tiefe sie jeden demokratischen Prozess untergraben muss.
Politik der Enteignung
Tatsächlich denkt Piketty auch beim Gegenmittel zu dieser Ungleichheit, der Enteignung, durchweg ganz erfrischend nicht nur in altbekannten Genossenschafts- oder Miniatur-Sowjetmodellen, bei denen alternatives Eigentum noch Handarbeit ist: Räume jenseits des Kapitalismus werden durch Hausbesetzungen geschaffen, oder indem man Häuser besetzt und in strauchelnden Fabriken die Kontrolle übernimmt. Diese Initiativen sind richtig und unschätzbar wertvoll, aber Piketty tut der Linken insgesamt einen Gefallen, wenn er in ihren Diskurs wieder Enteignung auf makroökonomischer Ebene einführt, an der auch eine gesellschaftliche Mehrheit unmittelbar teilhaben kann.
Das Privateigentum in Gestalt der gigantischen Schulden etwa, die Europa durch die Weltkriege angehäuft hatte, schmolzen laut Pikettys Daten durch eine politisch gewollte Inflation dahin, und führten so effektiv zu einer gigantischen Enteignung von privaten Eigentumsansprüchen. Dazu kam die „Erfindung“ progressiver Steuern, die von kleinen einstelligen Beträgen im 20. Jahrhundert regelmäßig auf weit über 50% kletterten, in Großbritannien für hohe Einkommen zwischen 1932 und 1980 im Durchschnitt 89% und für Erbschaften bis zu 72%. Diese Maßnahmen ergeben natürlich im engeren Sinne keine „sozialistische“ oder gar „revolutionäre“ Politik, und doch geht es darin um Größenordnungen, die uns heute oftmals selbst in radikaleren Kreisen unvorstellbar erscheinen.
Piketty setzt mit seinem neuen Buch auf empirische Weise ein Forschungsprogramm um, dass für Sozialist*innen heute eine wichtige Rolle spielt: Dass die bloße Feststellung, eine bestimmte Wirtschaftsweise sei ungerecht oder instabil, folgenlos bleiben muss, solange sie in der breiten Bevölkerung trotzdem ausreichend mit Legitimität versorgt wird, so irrational diese Legitimität auch sei. Nicht nur mit der Ökonomie, sondern vor allen auch mit der Wirksamkeit dieser Legitimationsmechanismen müssen revolutionäre Kräfte sich auseinandersetzen, also mit Kapital und Ideologie. Alleine für diese Forderung und die praktische Demonstration, dass dieses Thema mit den Methoden empirischer und politikwissenschaftlicher Forschung bearbeitet werden kann und muss, verdient es Piketty, gelesen zu werden.
Piketty und der Marxismus
Letztendlich unterscheidet sich Pikettys Auffassung von Kapital und Ideologie allerdings erheblich von revolutionär-marxistischen Theorien. Seine Weigerung, sich der reinen „Formanalyse“ hinzugeben, also dem reinen Marx-Lesefetischismus der großen Worte ohne politische Perspektive zu betreiben, wie es besonders in Deutschland heute wieder in Mode ist, droht ins Gegenteil zu kippen: Piketty ersetzt große Worte oft einfach durch große Zahlen. Eine These zum tatsächlichen inneren Zusammenhang von ökonomischen Prozessen und ihren ideologischen Folgen, wie sie zu sozialistischer Theorie gehört, findet sich hier nicht. Zwar spielen beide Seiten „irgendwie“ eine Rolle, doch lässt sich ihr Zusammenspiel für Piketty nicht auf einen gemeinsamen Nenner reduzieren, es bleibt, der Mode der modernen Wissenschaft folgend, kontingent. Das hat Vor- und Nachteile.
Historisch spielte sich das große ideologische Drama ja tatsächlich auf dem Terrain der einer formalen ökonomischen Frage ab. Marx’ Kritik an der klassischen Ökonomie, sie könne die Bewegung von Werten und Preisen (und vor allem die periodischen Krisen) nicht angemessen erklären, solange sie davon ausgingen, dass der Wert der Produkte vor allem aus dem eingesetzten Kapital und dem Grundeigentum an Boden entspringe, traf die damalige Ideologie zum Schutz dieser Eigentumsarten empfindlich. Entsprechend durchschlagend war das politische Potential, zumal in einer Zeit, in der den Arbeiter*innen trotz maximalem Einsatz nur ein Existenzminimum an Gütern zukam.
Heute haben sich die Dinge geändert: Insbesondere im Westen lebt eine breite Schicht an Arbeiter*innen relativ betrachtet sehr gut in einer Welt, in der die Produktionsfaktoren Kapital und Grundeigentum als wohlstandsfördernd gesehen werden. Die marxistische Kritik, aller Wert basiere nur auf Arbeit, findet – obgleich vielfach vorgetragen, zumal in der Corona-Krise – keinen rechten Widerhall in einer Welt von globalisierten Produktionsketten, wo die tatsächliche Arbeit oftmals ohnehin unsichtbar bleibt und wo materielle Krisen erfolgreich externalisiert werden: Legt eine Gesundheitskrise die Kaufhäuser lahm, verlieren nicht die schlesischen Weber von gegenüber ihre Anstellung, sondern die in der globalisierten Welt ohne Stimme und Recht gehaltenen. Obwohl die Lebensqualität subjektiv und vielleicht auch objektiv für die Massen im Westen stagniert oder sinkt, führt das oftmals gerade nicht zu einer internationalen Solidarisierung, sondern zu exklusiver Solidarität und Abschottung. Die internationale Hackordnung wird durchgesetzt und die Frage, wo Arbeit und Wert herkommen, die doch das Leben möglich machen, bleibt außen vor.
Pikettys großer Vorteil ist, in dieser Situation auf einen anderen Begriff verweisen zu können, der mehr Resonanz erzeugt und gleichzeitig politisch unverdächtiger daherkommt, nämlich den der Ungleichheit. Piketty versucht, den Niedergang der Sozialdemokratie zu erklären und stellt die These auf, sie habe einen Wandel zu einer „brahmanischen Linken“ vollzogen, sprich, einer vor allem als intellektuell definierten Klassenpolitik, die sich bewusst gerade vom Milieu der „unteren Klassen“ abgrenzt. Diese neue Sozialdemokratie schere sich nicht mehr genug um Ungleichheit.
Kritik der Sozialdemokratie und die „brahmanische Linke“
Das deckt sich zwar einerseits mit den Beschreibungen, wie sie etwa Didier Eribon liefert, der ebenfalls eine Abwendung der Linken von den unteren Klassen beschreibt. Doch lässt sich mit diesem Ansatz wirklich erklären, warum dieser Wandel passierte? Piketty schreibt:
Dieser große politisch-ideologische Wandel verlief allmählich, fortlaufend und weitgehend unvorhergesehen, indem der Bildungssektor wuchs. Anders gesagt haben sich linke Parteien ganz unwillkürlich und ohne konkrete Beschlüsse von Arbeiterparteien zu Akademikerparteien entwickelt (938)
Was sich als auf den ersten Blick als salomonische Erkenntnis ausgibt, bleibt als Analyse paradox: Gerade diejenigen sozialen Institutionen (die Berufspolitik mit ihren Parteien und ihrem Anhang aus Sozialwissenschaften, Presse und kritischer Intellektualität), die in ihrem professionellen Beruf und durch Verfassung und öffentliches Mandat darauf verpflichtet sind, Politik und Ökonomie im Sinne des Gemeinwohls zu gestalten, sollen den entscheidenden politisch-ideologischen Wandel des Spätkapitalismus in die Wege geleitet haben, ohne diesen Wandel vorhergesehen oder auch nur geahnt zu haben? Und ohne darüber einen öffentlich nachvollziehbaren Beschluss vorgelegt zu haben?
Piketty setzt gleich an mehreren wichtigen Stellen auf solche paradoxen „Erklärungen“. Für den Fall Frankreich konzentriert er sich beispielsweise auf die Frage, warum die linken Parteien, die seit den 1980er Jahren doch etwas mehr als die Hälfte der Zeit die Regierung stellten, den in Frankreich grassierenden „republikanischen Elitismus“ der Universitäten nicht nur nicht abstellten, sondern auch noch ausbauten. Seine Antwort: „Sie haben es nicht getan, zweifellos, weil sie die elitistische Finanzierungsstruktur der Hochschulbildung für gerechtfertigt hielten“. Für das Beispiel der USA heißt es: „Im Grunde hatten … die brahmanische Linke … und die kaufmännische Rechte … gemeinsame Interessen“. Linke Parteien haben für Piketty also deswegen keine linke Politik gemacht, weil sie in Wirklichkeit gar keine linken Parteien waren. Sie haben elitäre statt egalitäre Politik gemacht, weil sie entgegen den Erwartungen ihrer Beobachter*innen an elitäre, und nicht eben an egalitäre Werte glauben.
Eine solche Erklärung – die keine ist – wirft viel mehr neue Fragen auf als sie zu lösen vorgibt. Denn nun müsste sofort gefragt werden, wie es passieren konnte, dass sich die Strukturen der rationalen Nachvollziehbarkeit von politischer Gestaltung (die ja selber einst zu den Kernforderungen einer Sozialdemokratie gehörte, wenn sie Öffentlichkeit, Demokratie Transparenz, ein Ende der Geheimdiplomatie etc. forderte) in linken Parteien derart zersetzen konnten.
Die Unterscheidung zwischen „echter“ sozialdemokratischer oder sozialistischer Politik einerseits und ihrer inegalitären Deformation andererseits, für die es ja eine reiche Tradition gibt, die Piketty komplett ignoriert, bleibt systematisch außen vor. Die Stimmen der „radikalen“ Linken werden in einem soziologischen, rein deskriptiven Schema stets zusammen mit den übrigen sozialdemokratischen Stimmen einfach einem „internationalistisch-egalitären“ Block zugeschlagen. Dass die Unterscheidung von links und rechts bei Piketty (genauso wie bei so vielen anderen lauwarmen akademischen Kommentaren zur Gegenwart) kollabiert, liegt an der Weigerung, den Widerstreit zwischen Reformismus und revolutionärer Politik ernst zu nehmen. Seit über einem Jahrhundert wird um die Rolle des Reformismus im Niedergang der Sozialdemokratie gestritten – hat Piketty wirklich keine bessere Erklärung anzubieten, als diesen Niedergang einfach als Unfall der Geschichte zu erklären? Wo ist bei Piketty das konkrete Subjekt, dass seine weitreichenden Forderungen auch gegen den Widerstand des Kapitals umsetzen soll und den Chauvinismus in den Gewerkschaften, in den sozialen, feministischen und ökologischen Bewegungen zurückdrängen kann?
Der Karl Marx des 21. Jahrhunderts?
Es sind vier unmittelbare politische Forderungen, die von Piketty aufgestellt werden: 1) Die Einführung einer prozentualen Obergrenze beim Stimmrecht in Aktiengesellschaften. 2) Die Einführung einer „Erbschaft für alle“ in Höhe von 120.000 €. 3) Eine einheitliche, stark progressiven Steuer. 4) Die Aufnahme des Grundsatzes der Nicht-Regressivität in die Verfassungen Europas: Mit diesem Grundsatz dürften Steuern für die reichsten Bürger keinen geringeren Anteil ihres Einkommens und Vermögens mehr ausmachen als für die ärmsten.
Als Karl Marx des 21. Jahrhunderts, also als kritischer Begleiter und engagierter Berater einer sozialistischen Bewegung, kann Thomas Piketty damit nicht gelten. Das hat viel damit zu tun, dass eine solche sozialistische Bewegung, als deren radikaler Berater Piketty auftreten könnte, überhaupt nicht in derselben Weise in Sicht ist. Und auch auf der Ebene der politischen Theorie hat Piketty unverkennbar gerade deswegen eine so herausragende Position, weil er als radikaler Kritiker eben oft allein auf weiter Flur steht.
Von Seiten der liberalen Theorie, deren Programmatik in der Frage besteht, wie etwaige Krisen Legitimationsprobleme – man denke an den Demokratie- und Souveränitätsabbau und auch an das neue alte Steckenpferd der Sozialphilosophie, die „Entfremdung“ – einzudämmen und abzubauen wären – anstatt ihre systemischen Ursachen zu bekämpfen – ist auch kaum Hilfe zu erwarten. Nichtsdestotrotz kann die Diskussion von Pikettys Buch dazu dienen, den bürgerlichen Ökonomen den Spiegel der realen Verhältnisse vorzuhalten und die Jugend aus deren eingefahrenen Dogmen herauszuführen.
Fragen an Thomas Piketty bei der Online-Veranstaltung mit der Linkspartei
-
Wer wird die Enteignung der größten Vermögen durchsetzen?
-
Wie durchbrechen wir den Chauvinismus in Gewerkschaften und Sozialdemokratie?
-
Wo können wir die Ideologie des Proprietarismus praktisch bekämpfen?