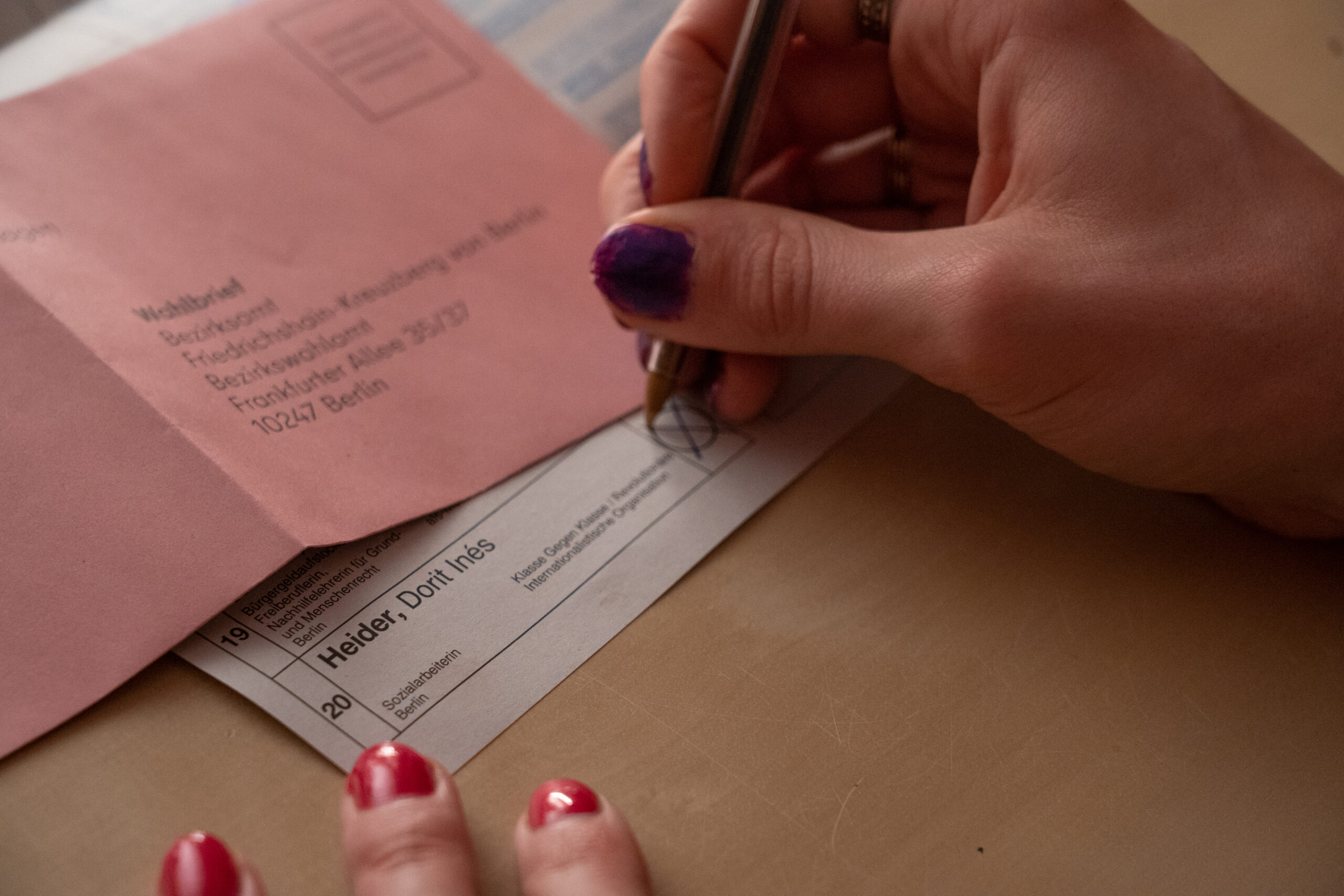Alle in der Krise, außer die CDU?

// Mit der niedersächsischen Landtagswahl im Januar begann das „Superwahljahr“ //
Mit der niedersächsischen Landtagswahl am 20. Januar wurde das Wahljahr 2013 eingeläutet, dessen Höhepunkt die Bundestagswahl im Herbst sein wird. Die wahrscheinliche Wiederwahl Merkels wird die Tür für weitere soziale Einschnitte und autoritäre Maßnahmen unter der Führung der Bundesregierung öffnen – sowohl in Südeuropa wie auch in Deutschland. In den ersten drei Monaten dieses Jahres bewegte sich einiges im bundesrepublikanischen Parteienregime, was die Frage der Perspektiven vor und nach der Wahl und die notwendige Antwort von RevolutionärInnen auf diese Aussichten aufgeworfen hat.
Dazu gehört zum einen die Landtagswahl in Niedersachsen, die einige Rückschlüsse auf die Konfliktlinien innerhalb der herrschenden Klasse in Deutschland zulässt, vor allem aber Hinweise auf die notwendige Strategie der deutschen Linken anhand des Negativbeispiels der Linkspartei gibt. Des Weiteren werfen die Skandale um die FDP und anhaltenden Schwierigkeiten des SPD-Kanzlerkandidaten – des bekennenden Neoliberalen, Mitarchitekten der Agenda 2010 und glühenden Verfechters von Hartz IV, Peer Steinbrück – ein Schlaglicht auf die Fragilität des Regimes der BRD.
Schlussfolgerungen aus Niedersachsen
Die große Überraschung der Niedersachsen-Wahl war das Abschneiden der FDP. Das beeindruckende Resultat von knapp 10% basierte hauptsächlich auf der Zweitstimmenkampagne der CDU, die relativ unverblümt zur Wahl der FDP mittels der Zweitstimme aufrief. Dies zeigt aber, dass die FDP als Partei noch nicht verschwunden ist, und dass ein bedeutender Teil der CDU-AnhängerInnen weiterhin mit der FDP als Juniorpartner sympathisiert. Dennoch ist die FDP weiterhin in einer tiefen Krise, die die Kontinuität der schwarz-gelben Koalition im Bund massiv in Frage stellt.
Zum anderen muss das desaströse Auftreten der Linkspartei ein Weckruf für all diejenigen sein, die sich von der neuen Parteispitze Riexinger-Kipping einen Richtungswechsel erhofft hatten. Ihre verzweifelten Versuche, eine – auch nur indirekte – Regierungsbeteiligung zu erreichen, waren ein Eigentor. Der gesamte Wahlkampf der Partei bestand darin, ein „linkes“ Korrektiv zur rot-grünen Koalition sein zu wollen. Linke Organisationen in der Linkspartei wie die SAV resümierten, dass anstatt eines Wahlkampfes für eine Regierungsbeteiligung ein Profil als „kämpferische Anti-Establishment-Partei und Systemopposition“ notwendig gewesen wäre. Das ist zwar nicht falsch, doch das Ende 2011 verabschiedete „Erfurter Programm“ der Linkspartei, auf welches sich diese Sektoren stattdessen beziehen, verkörpert mitnichten ein solches Profil. Es verbindet vielmehr einige verbalradikale Phrasen mit der völligen Abwesenheit eines Verständnisses von Klassenkampf in der Krise.[1] Daher ist auch nicht verwunderlich, dass die Linkspartei zur praktischen Opposition gegen die Pläne der KapitalistInnen bisher nichts beizutragen hat. Anstelle von vagen Hoffnungen darin, „dass einige Teile der Partei bereit sind die gescheiterte Strategie zu hinterfragen“, wie sie in der Wahlauswertung der SAV ausgedrückt werden,[2] muss die Schlussfolgerung sein, jegliche Illusionen in die Transformierbarkeit der Linkspartei aufzugeben, und außerhalb und auch gegen die Linkspartei einen Kampf gegen das Abladen der Krisenpolitik auf die ArbeiterInnenklasse und die Jugend zu führen.
Die FDP am Abgrund
Vor der Landtagswahl galt die FDP schon als tote Partei. Das spektakuläre Ergebnis vom 20. Januar verschiebt die Beerdigung der FDP zwar nach hinten, dennoch steht sie weiterhin am Abgrund. Dies macht zum zunächst der weiterhin schwelende Führungsstreit in der Partei deutlich: Nach dem Parteitag Mitte März ist Parteichef Rösler zwar bestätigt und sein größter Konkurrent Brüderle als Spitzenkandidat kooptiert, doch wichtige FDP-Figuren wie die Minister Niebel und Bahr sind innerparteilich katastrophal abgestürzt. Vor allem aber sorgen die Skandale um Sexismus und Rassismus innerhalb der Liberalen, gemeinsam mit dem innerparteilichen Widerstand gegen verschiedene Projekte der CDU (wie die EU-Finanztransaktionssteuer oder den Pseudo-Mindestlohn) dafür, dass Merkel und ihre Partei immer weniger auf ihren Koalitionspartner vertrauen können. Hinzu kommt, dass die FDP in den vergangenen Monaten selbst innerhalb ihrer traditionellen sozialen Basis massive Verluste hinnehmen musste, wie zuletzt die Abwendung des Apothekerverbands von der Partei deutlich machte.
Die FDP wird in ihrem Abwärtsstrudel immer unberechenbarer und gefährdet so die Stabilität der jetzigen und einer zukünftigen konservativ-liberalen Regierung, die in der Eurokrise eine starke Hand braucht, um ihre Austeritätsprogramme im In- und Ausland durchzusetzen. Angesichts der kommenden Aufgaben und der Unberechenbarkeit der FDP wird daher eine Große Koalition mit der SPD das für die Bourgeoisie sicherste und im Übrigen auch wahrscheinlichste Resultat der Bundestagswahl sein.
Quo vadis, SPD?
Währenddessen bereitet sich die SPD ebenfalls wieder auf eine Große Koalition vor. Zwar versucht die Partei mit der jetzt existierenden Möglichkeit, im Bundesrat eigene politische Vorstöße auch gegen die Regierung zu machen, eine rot-grüne „Alternative“ für die Bundestagswahl zu etablieren. (So verabschiedete der Bundesrat eine Initiative für einen flächendeckenden Mindestlohn und stemmte sich gegen den europaweiten Fiskalvertrag.) Doch dies wird nur Symbolpolitik bleiben, da die Initiativen von der schwarz-gelben Bundestagsmehrheit jederzeit abgeblockt werden können.
Falls die SPD die Bundestagswahl gewinnen sollte, wird sie die gemachten Wahlversprechen ganz schnell wieder vergessen. Davon zeugt die Kür von Peer Steinbrück zum Kanzlerkandidaten: Die Sozialdemokratie will sich angesichts der Bundestagswahl beim deutschen Kapital beliebt machen, wie schon zu Zeiten der Agenda 2010, wo sie die schärfsten Kürzungen und sozialen Angriffe auf die ArbeiterInnenklasse seit dem Zweiten Weltkrieg durchführte. Steinbrück ist aber bei Teilen der SPD-Basis alles andere als beliebt. So sah er sich genötigt, sich in kryptischen Worten dafür zu entschuldigen, im Wahlkampf in Niedersachsen für keinen „Rückenwind“ gesorgt zu haben. Im Klartext: Die SPD kann trotz, nicht wegen Steinbrück ins Regierungsgebäude in Hannover einziehen. Eine eigentlich erstaunliche Aussage für jemanden, der Kanzler werden möchte.
Steinbrücks Nominierung ist aber nur die logische Konsequenz der Neoliberalisierung der SPD, die selbst in Krisenzeiten keine fundamental anderen Rezepte anzubieten hat als die CDU. Das gerade verabschiedete Wahlprogramm der SPD spricht Bände: Die SPD versucht darin, die grundlegende „Richtigkeit“ der Agenda 2010 aufzuzeigen. Den sozialen Spagat soll dann die Forderung nach einer Vermögenssteuer, erhöhten Spitzensteuersätzen und einem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50€ erlauben. Diese Forderungen sind jedoch nicht mehr als Tropfen auf dem heißen Stein angesichts der antisozialen Agenda-Politik der SPD. Und so schafft es auch die CDU, mit Pseudo-Mindestlohn-Versprechen und der Abschaffung der Praxisgebühr soziale Versprechen für GeringverdienerInnen zu machen und sich sogar sozialer als die SPD gibt.
„Merkel, die Unverwüstliche“
Die CDU steht in dieser Konstellation fast als unverwundbar da. Zwar hat sie mit der Niedersachsen-Wahl schon wieder eine Landtagswahl verloren, doch in Umfragen liegt die Partei weiterhin bei 40%, und Bundeskanzlerin Angela Merkel ist die beliebteste politische Figur Deutschlands. Selbst die massenhaften Skandale und politischen Niederlagen hoher CDU/CSU-PolitikerInnen der letzten Jahre (Köhler, Guttenberg, Rüttgers, Wulff, Röttgen, zuletzt Schavan) konnten Merkels Regierung nichts anhaben. Die taz titelte deswegen im Zusammenhang mit der Schavan-Affäre: „Merkel, die Unverwüstliche“. Und tatsächlich scheint momentan kein Weg daran vorbei zu führen, dass Merkel im September wiedergewählt wird.
Dennoch ist für die herrschende Fraktion der deutschen Bourgeoisie nicht alles Friede-Freude-Eierkuchen. Erstens steht die positive Konjunkturentwicklung der letzten Jahre vor ihrem Ende: Deutschland ist in der Rezession angekommen, und mit Opel, ThyssenKrupp und anderen stehen nun auch Kernsektoren der deutschen Industrie im Kreuzfeuer der Krise. Zweitens gibt es durchaus Stimmen in der deutschen Bourgeoisie, die Merkel vor zu großen Zugeständnissen im Vorfeld der Bundestagswahl warnen und der Meinung sind, dass der Sparkurs wieder verschärft werden muss. Eine interessante Entwicklung in diesem Sinne ist die angekündigte Gründung einer bürgerlichen Anti-Euro-Partei mit dem Titel „Alternative für Deutschland“, welche es schaffen könnte, national orientierte Sektoren des deutschen Kapitals und rechtspopulistische „Bürgerinitiativen“, miteinander zu vereinen. Drittens hat die CDU das innerparteiliche Problem, dass Merkels Kurs zu einer quasi bonapartistischen Position Merkels im Innern der CDU geführt hat: Ohne Merkel steckte die CDU in einer großen Krise.
Und es gibt noch ein weiteres Problem: Die Krise der FDP zeigt deutlich auf, dass das bundesrepublikanische Parteienregime immer häufiger vor der Wahl zwischen fragilen Koalitionen mit kleineren Parteien oder einer Großen Koalition stehen wird, welche das Fundament des BRD-Nachkriegsregimes weiter ins Rütteln bringen werden. Die herrschende Klasse steht nämlich vor einem Dilemma: Will sie sich aufgrund der Krise der FDP auf die Möglichkeit fragiler Mehrheiten nach Wahlen einlassen – eine Variante, die angesichts der noch ungelösten Vorhaben der herrschenden Klasse in Bezug auf die Eurokrise und die Umstrukturierung des europäischen Arbeitsmarktes nach deutschem Gusto, schnell in sich zusammenbrechen könnte –, oder will sie eine Große Koalition bilden, die aus bürgerlicher Sicht die wohl sicherste Variante wäre? Letzteres aber ist aus parteipolitischer Sicht gleichzeitig am wenigsten zu befürworten. Denn in einer Großen Koalition verschwimmen die Grenzen zwischen den beiden großen Parteien, was vor allem bei den SozialdemokratInnen für Unmut unter Teilen der Basis sorgen wird. Somit werden der zentrifugale Prozess des Mitgliederschwunds sowiedie parteiinternen Fraktionsbildungen und Fraktionskämpfe beschleunigt.
Unter diesen Umständen könnten neue Parteien entstehen, die die Fundamente des bundesrepublikanischen Nachkriegsregimes stärker auf die Probe stellen. Dies hängt aber auch von der wirtschaftlichen Entwicklung und der Tiefe der zukünftigen Angriffe auf die ArbeiterInnenklasse ab. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch der hohe NichtwählerInnen-Anteil bei der Niedersachsenwahl, der bei über 40% lag und einen Hinweis auf den schwelenden Unmut über das Regime der BRD unter breiten Teilen der Bevölkerung gibt.
Die Fragilität nutzen
Die Aufgabe von RevolutionärInnen ist es, die wachsende Fragilität des Regimes zu nutzen, um eine Antwort auf die Krise zu geben, die nicht im Interesse des Kapitals, sondern der großen Mehrheit der Lohnabhängigen, RentnerInnen, MigrantInnen und der Jugend liegt.
Den negativen Beweis für eine solche Strategie bietet uns das grandiose Scheitern der Linkspartei in dieser Wahl. Als wenn noch ein Beweis nötig wäre, hat die Partei gezeigt, dass eine Orientierung auf ein „linkes“ parlamentarisches Korrektiv der Sozialdemokratie das genaue Gegenteil von Anti-Krisen-Politik ist, welche eine tatsächliche Alternative für die lohnabhängigen Massen der BRD wäre. Statt auf die Existenz eines linken Raums innerhalb einer Partei zu setzen, die trotz der kapitalistischen Krise nur Beschwerden darüber anzubieten hat, dass SPD und Grüne aus ihren Positionen abschreiben würden, wie es Marx21 und die SAV tun, ist es deshalb für RevolutionärInnen heute notwendig, die Frage nach einer Fusion mit den fortgeschrittensten Sektoren der ArbeiterInnenklasse und der Jugend in den Mittelpunkt zu stellen.
Prekär Beschäftigte, Frauen, RentnerInnen, Jugendliche und MigrantInnen sind dieser Krise bisher am Schärfsten ausgesetzt, und gerade sie sind die ProtagonistInnen unzähliger Kämpfe der letzten Monate. Gleichzeitig haben sie immer weniger Bindung zu den traditionellen bürgerlich-demokratischen Vermittlungsmechanismen der Parteien und Gewerkschaftsbürokratien. Es ist die oberste Aufgabe von RevolutionärInnen in dieser aktuellen Phase der Krise, diesen Sektoren eine Stimme zu geben, ihre Kämpfe zusammenzuführen und eine Perspektive aufzuzeigen, die die Selbstorganisierung der Kämpfenden vorantreibt.
Dazu ist es auch nötig, einen konsequenten Kampf gegen die bürokratischen Apparate zu führen, die den Kämpfen dieser Sektoren immer wieder Steine in den Weg legen. Dies zeigt gerade der Kampf der Beschäftigten von Neupack glasklar auf. Dies geht jedoch nur im Rahmen einer breiteren Strategie, die sich für den Aufbau einer revolutionären Partei in Deutschland und international einsetzt.
Fußnoten
[1]. Für eine ausführliche Kritik des Linkspartei-Programms siehe: Stefan Schneider: Linker als vorher – perspektivlos wie immer. In: Klasse Gegen Klasse Nr. 2.
[2]. Sascha Stanicic: Nach Niedersachsen.