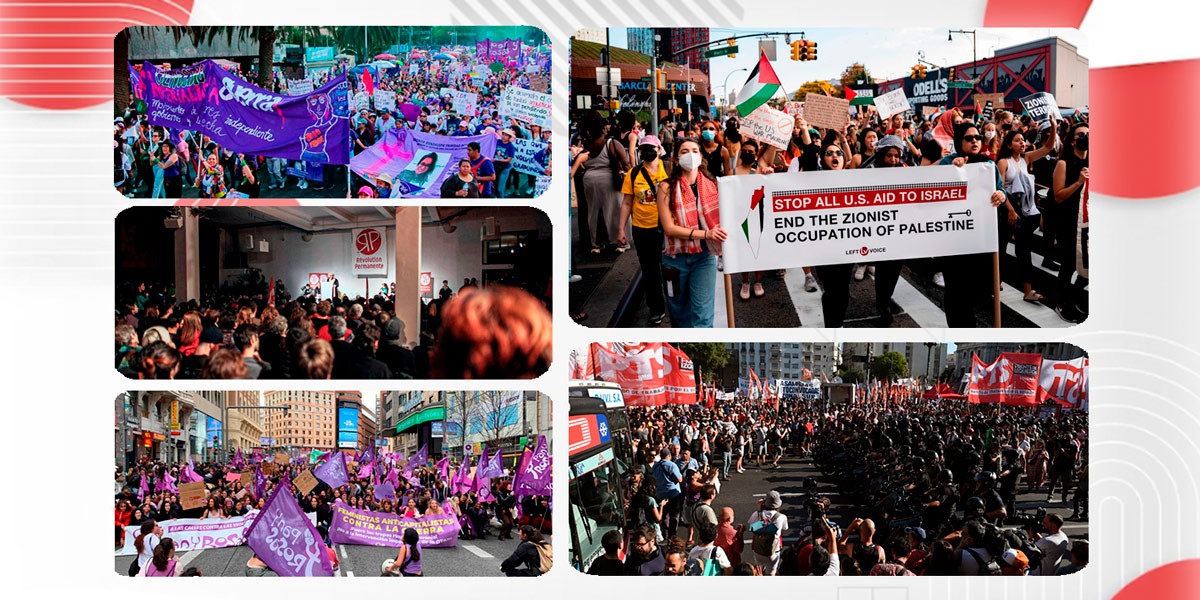Wozu dient die Einheitsfront?

// GESCHICHTE: Eine Debatte mit Marcel Bois, Autor eines Buches über die Linke Opposition der KPD. //
Im ersten Teil der Rezension von „Kommunisten gegen Hitler und Stalin“ haben wir die detailreiche Arbeit des jungen Historikers über die Linke Opposition der KPD gelobt. Dabei stellt sich die Frage: Was können Revolutionär*innen heute aus den vielfältigen Erfahrungen der linken Kommunist*innen lernen? Hier müssen wir ein bisschen mit dem Genossen polemisieren – es wäre nicht im Sinne der debattierfreudigen Strömungen der Linken Opposition, Kritikpunkte an diesem lesenswerten Buch zu verheimlichen.
Die Einheitsfront
Als die beiden großen Parteien der Arbeiter*innenbewegung, SPD und KPD, Anfang der 30er Jahre jede gemeinsame Aktion gegen die Nazi-Schlägertrupps ablehnten, war es eine zentrale Leistung der Linken Opposition, für eine antifaschistische Einheitsfront zu kämpfen. Doch Bois’ Darstellung der Einheitsfront ist nicht ohne Probleme.
Leo Trotzki, dessen Broschüren für die Einheitsfront große Verbreitung fanden, ging es in erster Linie darum, die Bastionen der Arbeiter*innenbewegung gegen faschistische Übergriffe zu schützen. Diese defensiven Aktionen würden Mitglieder aus KPD und SPD mit parteilosen Arbeiter*innen zusammenbringen. Dadurch würden auch Organe der Selbstorganisierung entstehen: antifaschistische Komitees in den Fabriken und Wohnvierteln, genauso wie in den Städten und im ganzen Reich. „Jeder Betrieb muß ein antifaschistisches Bollwerk werden, mit eigenen Kommandanten und eigenen Kampfmannschaften.“1
Plastisch schrieb Trotzki: „Ihr habt den Berliner Sowjet der Arbeiterdeputierten“, sobald die Einheitsfront in der Reichshauptstadt zusammentritt. Ein solcher „Sowjet“ (das russische Wort für „Rat“) würde sich nämlich nicht auf antifaschistischen Selbstschutz beschränken, sondern für alle Forderungen der Arbeiter*innen kämpfen. Bei dieser „sowjetischen Strategie“ Trotzkis ging es darum, die Grundlage für eine revolutionäre Regierung der Arbeiter*innen zu schaffen.
Denn der Faschismus fiel nicht vom Himmel: Die Kapitalist*innen brauchten die Nazis im Rahmen der Weltwirtschaftskrise, um die Errungenschaften der Arbeiter*innen zu vernichten. Hitler konnte nur durch den Sturz des Kapitals endgültig besiegt werden. Eine revolutionäre kommunistische Partei würde also den Kampf gegen Hitler nutzen, um die Mehrheit der Arbeiter*innen für eine revolutionäre Perspektive zu gewinnen. Trotzki nannte diese Politik eine „aktive Verteidigung mit der Perspektive eines Übergangs zur Offensive“.2
Nur defensiv?
Deswegen ist es erstaunlich, dass der Genosse Bois die Politik der Einheitsfront als rein defensives Abkommen auslegt – den einzigen Verweis auf ein offensives Moment verbannt er buchstäblich in eine Fußnote (S. 354, Anm. 42). Deswegen kann er zum Beispiel nicht verstehen, warum die Linke Opposition nicht mit den „rechten“ Kommunist*innen unter Brandler und Thalheimer, die ebenfalls für eine Einheitsfront von SPD und KPD eintraten, zusammengehen konnte (S. 371). Doch für Trotzki und seine Mitstreiter*innen ging es nicht um eine Einheitsfront als Selbstzweck, sondern als eine Forderung im Rahmen eines Aktionsprogramms, das die KPD zurück auf einen revolutionären Kurs bringen sollte. Aus diesem Grund konnten sie keine Einheit mit „Rechten“ bilden, die trotz taktischer Kritikpunkte die stalinistische Führung in der Sowjetunion unterstützten.
Bois klingt die Einheitsfrontpolitik eher so: „Mit Kampagnen die Wirklichkeit verändern“ (so der Titel eines Workshops von Bois mit Bernd Riexinger, dem Vorsitzenden der Linkspartei). So wird die Einheitsfront zu einem Kampagnenvorschlag von einer reformistischen Partei (LINKE) an eine andere (SPD) – und nicht als taktisches Mittel von Revolutionär*innen, um den Einfluss von reformistischen Bürokrat*innen durch gemeinsame Aktionen zu bekämpfen. Trotzki meinte, diese Politik könne „nur von einer kampferprobten revolutionären Partei geführt“3 werden – aber dieser Gedanke fehlt bei Bois, der selbst Mitglied der Linkspartei ist.
Dabei zeigt die Politik der Einheitsfront doch, wie Revolutionär*innen heute mit der Linkspartei umgehen sollten: Nicht etwa durch eine „kampagnenorientierte“ Mitarbeit in ihr, sondern durch gemeinsame Aktionen, verbunden mit permanenter und schonungsloser Kritik.
Totalitarismus
Der Titel von Bois’ Buch, der Hitler und Stalin in eine Reihe setzt, ist denkbar unglücklich gewählt. Denn ein zentrales Element der herrschenden Ideologie im heutigen Deutschland ist die „Totalitarismustheorie“, die Faschismus und Stalinismus gleichsetzt, um die bürgerliche Demokratie als einzige Alternative zur Diktatur zu präsentieren.
Für Trotzki dagegen war es natürlich klar, dass Hitler und Stalin von der Form her viele Ähnlichkeiten aufwiesen: Der „Generalsekretär“ wurde von offizieller Seite genauso mystifiziert wie der „Führer“. Doch der gesellschaftliche Inhalt beider Systeme war geradezu entgegensetzt: Hitlers Regime schützte die Bourgeoisie und vermehrte ihr Kapital um ein Vielfaches – Stalins Regime dagegen basierte auf der Enteignung des Kapitals durch die Oktoberrevolution von 1917. Auch wenn Stalins Bürokratie die Arbeiter*innenräte bereits entmachtet hatte, blieben die Produktionsmittel in Händen des Staates, der die Bourgeoisie weiterhin niederhielt.
Bois’ Geschichte der Linken Opposition bietet viele wichtige Lehren für RevolutionärInnen heute. Doch Bois selbst zieht manchmal die falschen, opportunistischen Schlussfolgerungen aus seiner Arbeit.
Marcel Bois: Kommunisten gegen Hitler und Stalin. Die Linke Opposition der KPD in der Weimarer Republik. Klartext Verlag, Essen 2014. 613 Seiten.
Fußnoten
1. Leo Trotzki: Wie wird der Nationalsozialismus geschlagen?
2. Leo Trotzki: Die Tragödie des deutschen Proletariats. In: Ebd.: Porträt des Nationalsozialismus. Essen 1999.
3. Leo Trotzki: Was nun? Kapitel 13: Streikstrategie.