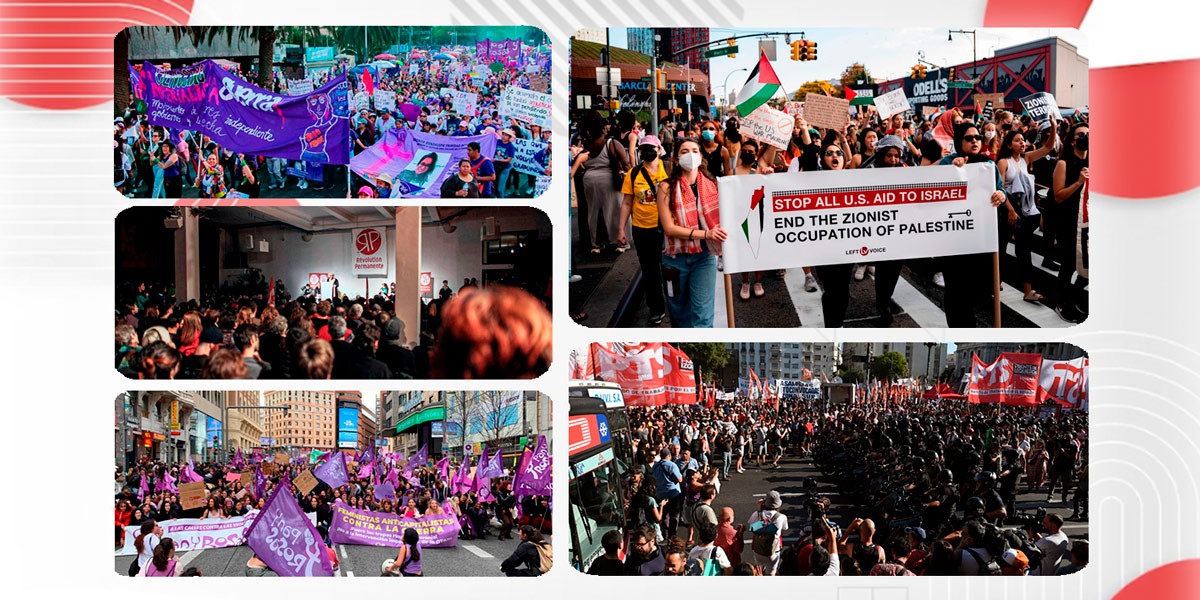US-Vorwahlen: Aufstand gegen das Establishment?

Die erste Runde der Vorwahlen in den USA bestätigt das dynamischste politische Phänomen: die Revolte der Wähler*innen gegen das Establishment beider Parteien.
Der Unmut mit der Politik „as usual“ brachte dem ultra-rechten texanischen Senator Ted Cruz mit Verbindungen zur Tea Party den Sieg unter den Republikaner*innen. Bei den Demokrat*innen verhinderte er den eindeutigen Triumph von Hillary Clinton, die mit dem Senator Bernie Sanders auf einen Gleichstand kam.
Doch auch wenn es scheint, als würden sich beide Lager radikalisieren, geht ihre Tendenz in die jeweils entgegengesetzte Richtung. Die Feinde derjenigen Republikaner*innen, die für Ted Cruz, Donald Trump und Marco Rubio stimmten, sind das „Big Government“, die Migrant*innen, die Muslime, die Steuern, die „verräterischen“ Republikaner*innen und der Einfluss des Staates, der als Angriff auf den radikalen Individualismus gesehen wird. Die Basis derjenigen Demokrat*innen, die für Sanders stimmten, stellt sich gegen die Ungleichheit, die Kriege, die Wall Street und ihre Politiker*innen.
Die Ergebnisse von Iowa sind nicht definitiv. Der Bundesstaat stellt nur einen kleinen Anteil der Delegierten für die Parteikongresse: 44 von 4.763 Demokrat*innen und 30 von 2.472 Republikaner*innen. Außerdem wird immer noch in Versammlungen (caucus) abgestimmt, wie es nur noch in wenigen anderen Bundesstaaten der Fall ist. Doch die Ergebnisse können den Vorwahlen ihr Siegel aufdrücken und die Strategie des restlichen Wahlkampfes beeinflussen.
Winners and losers
Auf der republikanischen Seite gab es eine Reihe von Verlierer*innen und nur zwei Gewinner. Neben dem Ergebnis war auch die zunehmende Beteiligung eine Überraschung: 185.000 Menschen nahmen an den republikanischen Caucus teil, was eine Zunahme von 54 Prozent gegenüber der meistbesuchten Vorwahl bedeutet.
Unter den Gewinnern befindet sich offensichtlich Ted Cruz, der mit 28 Prozent die meisten Stimmen bekam und den unkonventionellen Charakter seiner Kandidatur betonte. In seiner Kampagne richtete er sich durch verschiedene Bezüge zu Christus an die evangelikale Basis und griff die „verräterischen“ Republikaner*innen und das an, was er in seiner Siegesrede als Washingtoner Kartell bezeichnete. Cruz nahm zudem zahlreiche von Donald Trumps „Vorschlägen“ auf, wie den Bau einer Mauer an der Südgrenze mit Mexiko oder die Abschiebung von Millionen nicht-registrierter Arbeiter*innen.
Der andere Sieger war der Senator aus Florida, Marco Rubio, der mit 23 Prozentpunkten Dritter wurde und nur knapp hinter Trump blieb. Sein Sieg bestand darin, das er sich in dieser ersten Vorwahl als eine gangbare Möglichkeit für das Establishment der Partei präsentierte, da Rubio neben der extrem rechten Demagogie von Cruz und Trump als gemäßigt erscheint. In seiner Rede am Montagabend hob er diese strategische Position hervor. Rubio stellte sich als denjenigen Kandidaten dar, der neue Sektoren gewinnen kann, die über die radikalisierte republikanische Basis hinausgehen, deren Positionen bei der Gesamtheit der Wähler*innenschaft in der Minderheit sind.
Der große Verlierer ist Donald Trump, der mit 24 Prozent Zweiter wurde, auch wenn er durch seine Kampagne den politischen Diskurs der Republikaner*innen an den rechten Rand schieben konnte. Das heißt natürlich nicht, das er aus dem Rennen ist. Doch er hat die Aura der Unbesiegbarkeit verloren, die er in den vergangenen Monaten aufbaute, in denen er die Umfragen anführte. Zudem erlitt er eine persönliche Niederlage, da sich der Großteil seiner Kampagne auf seine Person bezieht, die er als Siegerpersönlichkeit auf allen Ebenen verkaufen möchte, beginnend mit seinem riesigen Privatvermögen.
Weit abgeschlagen kommt eine ganze Reihe von fünf (Ex-)Gouverneuren, mit Jeb Bush an der Spitze. Zusammen bekamen sie weniger als acht Prozent, die der ehemalige Neurochirurg Ben Carson bekam. Das Problem der republikanischen Partei und der US-Bourgeoisie liegt darin, dass hinter diesen Losern das Establishment der Partei und der herrschenden Klasse steht: Mehr als 100 Millionen US-Dollar stellten die großen Unterstützer*innengruppen für Jeb Bush zur Verfügung, der auf weniger als 3 Prozent kam.
Auf der Seite der Demokrat*innen endeten die beiden Spitzenkandidat*innen fast in einem Unentschieden. Hillary Clinton sagt in ihrer Rede, dass sie „erleichtert aufatmen“ konnte, doch mit ihrer hauchdünnen Führung konnte sie die Geister der Niederlage in Iowa gegen Obama vor 8 Jahren nicht vertreiben. Nichtsdestotrotz schnitt sie diesmal wesentlich besser ab: Sie bekam die Hälfte der Stimmen und der Delegierten, im Vergleich zum dritten Platz (hinter Obama und John Edwards) wie bei ihrer ersten Präsidentschaftskandidatur.
Doch wenn man einen der beiden als Gewinner*in bezeichnen kann, ist es Bernie Sanders. Der „sozialistische“ Senator aus Vermont lag im April vergangenen Jahrs 40 Prozentpunkte hinter Clinton. Was als die Krönung von Clinton anlief, verwandelte sich seitdem in einen harten Wahlkampf. Das bestätigt sowohl das Ergebnis von Iowa als auch das allgemeine Wachstum seiner Kampagne.
Die interessanteste Tatsache ist die Zusammensetzung der Wähler*innen der beiden demokratischen Kandidat*innen. Laut der von Edison Research veröffentlichten Studie bekam Sanders 84 Prozent der Stimmen der Jugendlichen zwischen 17 und 29 Jahren; 57 Prozent der Familien mit Einkommen unter 30.000 US-Dollar jährlich und 50 Prozent derer mit Einkommen zwischen 30.000 und 50.000. Außerdem wählten 59 Prozent aller Personen, die zum ersten Mal an einem Caucus teilnahmen (vier von zehn Demokrat*innen) Sanders. Seine Stimmen bündelten sich in den Versammlungen in der Nähe von staatlichen Universitäten. Hillary Clinton wiederum siegte in dem Sektor der über 65 jährigen (69 Prozent), der Familien mit Einkommen zwischen 50.000 und 100.000 US-Dollar (50 Prozent) und bei den Frauen, die für sie als Frau und Verfechterin des Rechts auf Abtreibung stimmten.
Ein weiteres Element, das für die große Unterstützung von Sanders Kampagne spricht, ist die Finanzierung, besonders die 20 Millionen US-Dollar, die er im Januar hauptsächlich durch kleine Spenden sammeln konnte. Es kommen Erinnerungen an die Kampagne von Obama hoch, auch wenn sie lange nicht an die Reichweite von damals herankommen.
Nichtsdestotrotz ist Iowa ein nicht repräsentativer Bundesstaat, da die große Mehrheit der Wähler*innen weiß und religiös ist, während es wenig Afroamerikaner*innen und Latinos gibt, unter denen Hillary Clintons Anhänger*innenschaft größer ist.
Was nach Iowa bleibt
Iowa warf ein Blitzlicht auf die soziale und politische Polarisierung, die sich mit der Großen Rezession etablierte.
Wie es auch schon bei anderen Vorwahlen war, wurde der Beginn der Kampagne stärker von der Basis der Parteien bestimmt. Das wird sich immer weiter auflösen, sobald die Zeit der Entscheidungen naht. Dann übernehmen die „Superdelegierten“ und andere Mechanismen des Apparats die Kontrolle. Die Stimmung an der Basis ist von Frustration und Unmut mit dem traditionellen politischen Personal des Zweiparteiensystems geprägt, was sich in der Unterstützung von Kandidaten ausdrückt, die auf die eine oder andere Weise als Outsider wirken. Doch ein Demagoge wie Donald Trump lässt sich schwer als „Anti-Establishment“ bezeichnen, weil es sich um einen Milliardär handelt, der jährlich in der Forbes-Liste der reichsten Personen erscheint. Genauso wenig ist es der Protestant Ted Cruz, der für die sprechen möchte, die es nicht geschafft haben, während seine Frau im Vorstand von Goldman Sachs sitzt.
Die große Aufspaltung bei den Republikaner*innen (sie hatten bis zu 17 Anwärter*innen, von denen elf übrig blieben, was sich jedoch in der kommenden Zeit noch weiter verringern wird) birgt eine schwierige Zukunft. Dazu kommt, dass keiner der meist gewählten Kandidaten gemäßigt konservative Positionen vertritt. Deswegen hoffen einige, und auch Marco Rubio selbst, dass angesichts der schlechten Ergebnisse der Partei-Eliten die Unterstützung zu Rubio übergeht. Dieser hat den Vorteil, der rechten Politik ein freundlicheres Antlitz zu verleihen und steht damit im Gegensatz zu Ted Cruz mit seinen Verbindungen zur Tea Party und Donald Trump. Natürlich haben die Republikaner*innen nichts gegen rechte Politik. Doch die Demagogie und der Fanatismus von Trump und Cruz (und der Tea Party) sind nicht das beste Antlitz für eine der wichtigsten Parteien des US-Kapitals und machen es schwieriger, neue Wähler*innenschichten zu gewinnen.
Die Demokrat*innen werden ihre Vorwahlen leichter überstehen, zumal Sanders schon vorher seine Unterstützung für jede*n Kandidat*in – also Hillary Clinton – zusicherte. Doch das wichtige ist nicht Senator Sanders und seine versöhnliche Politik, sondern was seine Kampagne und die Themenschwerpunkte wie das Ende der Ungleichheit, Lohnerhöhungen, die Verurteilung der Wall Street und des Großkapitals ausdrücken.
Die „politische Revolution“ von Sanders ist eine optische Täuschung, doch die Bedingungen, die zu seinem Aufstieg führten, sind es nicht. Diese liegen in der Konzentrierung des Reichtums, den Lohnkürzungen (der Durchschnittslohn liegt 4.000 US-Dollar unter dem von 2008), den mehr als 48 Millionen US-Amerikaner*innen, die auf staatliche Unterstützungen angewiesen sind, um sich zu ernähren, den zwölf Millionen un-registrierten Arbeiter*innen, dem Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit und der imperialistischen Kriege.
Sanders Kampagne brachte nicht nur den Unmut der Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung ans Tageslicht, sondern auch, dass ein nicht unbedeutender Teil von Jugendlichen und Arbeiter*innen Reden über „Sozialismus“ und „Revolution“ hören wollen, die als verbotene Worte im Herzen des weltweiten Kapitalismus gelten. Auch wenn die Bedeutung, die Sanders den Worten gibt, nichts mit dem Ende einer auf Ausbeutung basierenden Gesellschaft zu tun hat, ist die politische Entwicklung, die das ausdrückt, ein erfreuliches politisches Zeichen.